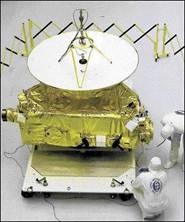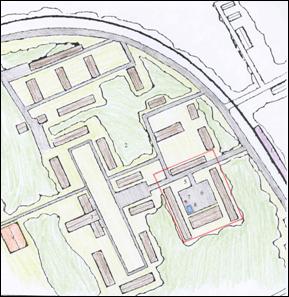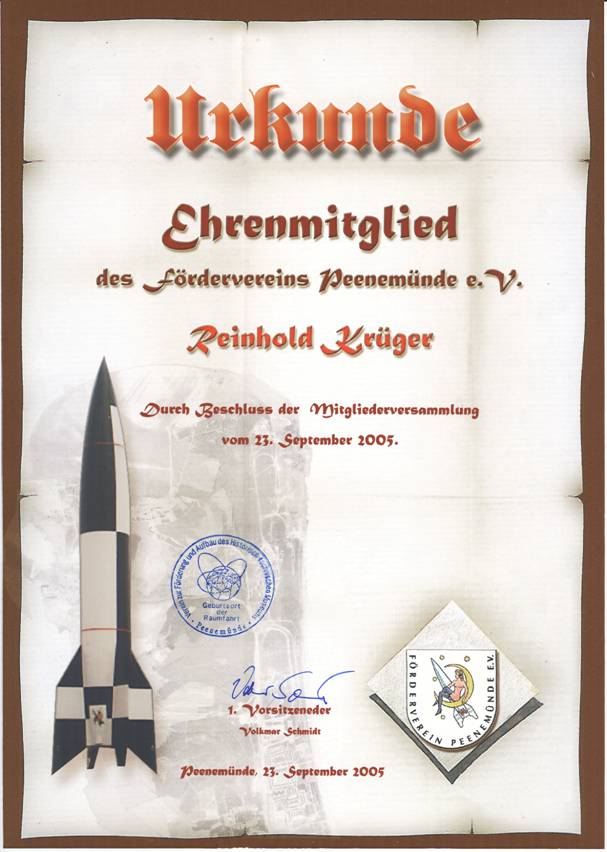
Die Urkunde unseres
Ehrenmitgliedes Reinhold Krüger
Rückblick 2005 und Aufgaben für 2006
Liebe Vereinsmitglieder und
Freunde unseres Vereins,
obwohl dieses Jahr schon
wieder fast drei Monate alt ist, möchte ich mich in der ersten Ausgabe des
diesjährigen Infoblattes unseres Vereins noch einmal mit einem kurzen Rückblick
auf 2005, sowie einer Vorschau für 2006 an Sie wenden.
Wie bereits im Bericht des
Vorstandes auf unserer Jahreshauptversammlung dargelegt, war die Zusammenarbeit
mit dem Leiter des Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde,
Herrn Zache, fast vollständig zum erliegen gekommen. Wir hatten aus diesem
Grund eine Satzungsänderung mit dem Ziel der Streichung der Förderung des
Museums zur Diskussion gestellt.
Die Mitteilung, dass Herr Zache das HTI
verlässt, um eine neue Aufgabe im Ruhrgebiet zu übernehmen, hat für uns eine
völlig andere Situation geschaffen, die uns neue Hoffnung auf eine
Zusammenarbeit gibt.
Nach einer bundesweiten
Ausschreibung bewarben sich über 70 Kandidaten um die Stelle als Leiter des
HTI. Die Wahl fiel einstimmig auf Herrn Mühldorfer-Vogt, einen qualifizierten
Fachmann, der als Leiter der Museen in Quedlinburg eine in Fachkreisen
anerkannte Arbeit leistete. Am 02.Januar nahm er seine Tätigkeit in Peenemünde
auf. Noch in der ersten Woche fand ein Treffen mit ihm statt, an dem Klaus
Felgentreu, der Bürgermeister von Peenemünde, Rainer Barthelmes und ich
teilnahmen.
In diesem ersten Gespräch
wollten sich die Teilnehmer miteinander bekannt machen und über eine zukünftige
Zusammenarbeit sprechen. Obwohl Herr Mühldorfer-Vogt in den wenigen Tagen nach
seiner Amtsübernahme noch nicht über ein fertiges Konzept verfügen konnte,
hatte er doch klare Vorstellungen über die weitere Entwicklung des Museums, die
in vielen Punkten mit unserer Sichtweise übereinstimmten. Dieses Gespräch
stimmte uns zuversichtlich, dass die Arbeit des Vereins wieder gewünscht ist
und dass es in Zukunft wieder Projekte mit unserer Beteiligung geben wird.
Schon vierzehn Tage später
wurde das erste gemeinsame Projekt beraten und mit der Vorbereitung begonnen.
Von einem niederländisches Museum wurden Teile einer Walterschleuder zum Kauf
angeboten. Der Vorstand beschloss einstimmig, dass sich der Verein mit den
Spendengeldern von Max Mayer und Konsul Niethammer daran beteiligt. Damit wird
der Zweckbestimmung, diese Mittel für eine Darstellung des Werks „Peenemünde
West“ einzusetzen, eingehalten. Weiterhin wollen wir uns aktiv an der
Konservierung und Restaurierung der Walter-Schleuder beteiligen. Zur
Besichtigung des Objektes und zur Verhandlung über den Erwerb des Exponates
sind Klaus Felgentreu und Peter Profe nach Hengelo/Holland gefahren. (siehe
Bericht Klaus Felgentreu)
Für das Jahr 2005 möchte ich
noch einmal besonders erwähnen, dass sich der Kontakt mit dem Internationalen
Förderkreis für Raumfahrt, insbesondere mit seinem Präsidenten Herrn Prof.
Kramer, durch die Teilnahme an der Jahrestagung in Garmisch Partenkirchen
weiter gefestigt hat.
Diese Reise benutzte ich auch
für Besuche von Mitgliedern und Freunden unseres Vereins, die sich besonders
für unsere Arbeit eingesetzt haben und denen leider eine Reise zu unseren
Veranstaltungen zu beschwerlich ist. So besuchte ich zunächst den langjährigen
Präsidenten der Interessengemeinschaft der ehemaligen Peenemünder Herrn Heinz
Grösser. Ich freue mich besonders, dass durch unser Gespräch einige
Missverständnisse aus der Vergangenheit ausgeräumt werden konnten und wir uns
in gutem Einvernehmen trennten. Das war für mich sehr wichtig, weil Herr Grösser,
der eine große Arbeit bei der Organisation der Interessengemeinschaft der
Ehemaligen Peenemünder geleistet hat, unseren Respekt verdient.
Besonders herzlich wurde ich
von Herrn Konsul Niethammer und seiner Gattin aufgenommen. Konsul Niethammer
besitzt eine umfangreiche (vielleicht die umfangreichste) Sammlung von
Unterlagen über die Fi 103, an deren Entwicklung er als junger Mann aktiv
mitgearbeitet hat. Ich konnte mich wieder einmal von der Einmaligkeit dieser
Sammlung überzeugen. Die Geschenke und Spenden, die wir für die Darstellung der
Geschichte des Werks „Peenemünde West“ verwenden wollen, werden wir in Ehren
halten.
Mein letzter Besuch galt der
Witwe des verehrtem General Walter Dornberger. Für mich war es eine besondere
Ehre, dass sie mich empfangen hat und mir von Stationen aus ihrem gemeinsamen
Leben nach 1945 erzählte. Besonders hat mich ihr Bericht über die aufrichtige
Freundschaft Walter Dornbergers mit Wernher von Braun beeindruckt. Auch der
Kontakt Walter Dornbergers zu den ehemaligen Mitarbeitern aus Peenemünde ist
nie abgerissen. Zum Abschied übergab mir Frau Dornberger eine gerahmte Urkunde,
die von den ehemaligen engsten Mitarbeitern in Peenemünde anlässlich des 70.
Geburtstag ihres Mannes, Walter Dornberger, durch Wernher von Braun überreicht
wurde. Diese Urkunde trägt auch die Unterschrift von Wernher v. Braun.
Weiterhin habe ich die Originalausgabe der Biographie über Wernher von Braun
mit einer persönlichen Widmung des Autors Ernst Stuhlinger erhalten. Ich habe
Frau Dornberger mein Wort gegeben, dass wir diese Gaben in Ehren halten werden
und nur in einer angemessenen und würdigen Form im Sinne ihres Mannes verwenden
werden.
Für das Jahr 2006 wollen wir,
wie bereits eingangs erwähnt, die Zusammenarbeit mit dem HTI wieder aktivieren.
Die Realisierung des Projektes „Walterschleuder“ könnte der Anfang sein.
Am 27.01.2006 tagte der
wissenschaftliche Beirat für das HTI. Auf dieser Konferenz wurde der neue
Leiter des Museums vorgestellt, die bisherigen Ergebnisse ausgewertet und die
Schwerpunkte für die weitere Arbeit bestimmt.
Ein Ständiger Rückgang bei
den Besucherzahlen auf 250.000 führte dazu, dass das HTI im Jahr 2005 das erste
Mal rote Zahlen schrieb.
Die Umstrukturierung des als
kommunaler Eigenbetrieb der Gemeinde Peenemünde arbeitenden Museums in eine
Stiftung öffentlichen Rechts gestaltet sich schwierig, weil eine Finanzierung
durch Bund und Land noch nicht gesichert ist.
Die Kontakte nach Huntsville
sollen wiederbelebt werden und die Wernher von Braun- Ausstellung nach
Peenemünde als Dauerausstellung geholt werden.
Zum Abschluss möchte ich alle
Mitglieder und Freunde unseres Vereins zu unserem diesjährigen Treffen mit
Jahreshauptversammlung, wie bereits angekündigt, vom 28.09.06 bis 02.10.2006
einladen.
Volkmar Schmidt
1. Vorsitzender
Sitzungen des Vorstandes
1. Angeregt durch das erste Gespräch mit dem neuen Leiter des HTI, Herrn
Christian Mühldorfer-Vogt, beschloss der Vorstand auf seiner Sitzung am
06.01.2006, das HTI finanziell bei der Beschaffung von 16 Originalteilen einer
Walterschleuder zu unterstützen. Dazu sollen auch die Spenden, die wir
anlässlich des Todes von Max Meyer erhalten haben, genutzt werden.
Wir sehen hier eine Möglichkeit,
uns als Förderverein beim Aufbau der Walterschleuder auf dem Freigelände im HTI
einzubringen. Das Angebot diese Originalteile zu erwerben, kam aus Holland. Aus
diesem Grund sind Herr Profe, Stellv. Leiter des HTI, und ich am 08./09.02.2006
nach Holland gefahren, um diese Teile zu besichtigen. Wir konnten feststellen,
dass der gute Zustand dieser Originalteile den Ankauf für das HTI rechtfertigt.
Nun geht es darum, den Transport zu
organisieren, damit schnellstens mit der Konservierung und der nachfolgenden
Aufstellung der Walterschleuder auf dem Freigelände des HTI begonnen werden
kann.
Das HTI hofft natürlich auf aktive
Unterstützung durch unseren Verein. Darum sind Spenden von unseren
Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins für dieses gemeinsame Projekt
weiterhin sehr gefragt!
2. Der Vorstand bedankt sich bei Frau Dornberger für die wunderbare
Erinnerungsurkunde, die anlässlich des 70. Geburtstages ihres Mannes, 1965, mit
der Unterschrift von W. v. Braun, sowie mit den Unterschriften vieler
ehemaliger Peenemünder angefertigt wurde.
Bei Herrn Diecke bedanken wir uns
für die Bücher über die Raumfahrt und bei Herrn Helm für die aussagekräftigen
und interessanten Kalender 2006 über Peenemünde West.
3. Am 05.01.06 trafen sich Herr Schmidt und Herr Felgentreu im Auftrag
des Vorstandes zu einem ersten Gespräch mit dem neuen Leiter des HTI, Herrn
Christian Mühldorfer - Vogt. Teilnehmer war auch der Bürgermeister von
Peenemünde, Herr Barthelmes.
Als sehr wichtig wurde eine enge
Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und dem neuen Leiter des HTI von beiden
Seiten angesehen. Dieses einstündige Gespräch wurde in einer offenen und
konstruktiven Atmosphäre geführt. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es sich
wieder lohnt, das Wissen und Können unserer Vereinsmitglieder für die weitere
Erforschung der Peenemünder Geschichte im HTI einzubringen.
Der Vorstand hat die Absicht, Herrn
Mühldorfer-Vogt zu einer der nächsten Sitzung einzuladen, um weitere konkrete
Schritte der Zusammenarbeit zu besprechen.
Klaus Felgentreu
2. Vorsitzender
Peenemünde im Spiegel der Presse
Ostseezeitung 30. Januar
2006
Außenareal
des HTI soll sich verändern
Erste Ideen
des neuen Museumsleiters in Peenemünde äußerte dieser jetzt vor den Mitgliedern
des HTI- Beirates und stieß auf Zuspruch.
Peenemünde Erste Vorstellungen für die Weiterentwicklung des
Historisch-Technischen Informationszentrums (HTI) hat der neue Leiter des
Museum, Christian Mühldorfer-Vogt, am vergangenen Wochenende bei der Tagung des
HTI- Beirates in Peenemünde entwickelt. „Es sind erste Ideen, die ich habe und
die vom Beirat positiv aufgenommen wurden“, so der frisch gebackene
Museumsleiter.
Zum einen will Mühldorfer-Vogt die Marketing-Strategie stärker auf das Besondere des Museums ausrichten. Dafür werde in Kürze die Beschilderung und Werbung verändert. „Wir wollen das Alleinstellungsmerkmal des HTI stärker hervorheben, aggressiver werben“, sagte Mühldorfer-Vogt auf O-Nachfrage. Außerdem schwebt dem Nachfolger von Dirk Zache vor, sich in nächster Zeit verstärkt dem 12 000 Quadratmeter großen Außenbereich des Museums zuzuwenden und diesen neu zu strukturieren. „Wie in der Dauerausstellung möchte ich die dort zu sehenden Exponate in eine zeitliche Abfolge bringen“, so Mühldorfer-Vogt. „Chronologische Inseln“, nennt der Museologe, der aus Quedlinburg auf die Insel kam, sein Konzept. So könnte die Werkbahn, die restauriert werden soll, als Exponat die Zeit von 1936-45 im Außenbereich präsentieren. Museumsschiff und Flugzeuge stehen für die Zeit nach 1945. „Wenn ich nicht vehementen Widerspruch erfahre, werde ich das umsetzen“, so Mühldorfer-Vogt. Mit Widerstand ist indes nicht zu rechnen. Mehr als positiv angetan zeigte sich Dr. Christoph Ehmann, Vorsitzender des HTI- Beirates, von der Begegnung mit dem neuen Peenemünder Museumsleiter. Er betonte das harmonische Miteinander der ersten gemeinsamen Beratung.
Laut Ehmann will sich der Beirat nun vehement für ein stärkeres Engagement von Land und Bund für das HTI Peenemünde einsetzen. Vor allem die Ruinen im Ortsbild, die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet werden, müssten schnellstens verschwinden. „Die Politik des Bundes läst den Ort verkommen“, so Ehmann.
ANTJE ENKE
Ostseezeitung
Dienstag, 10. Januar 2006
Neuer
Museumschef plant Wernher- von- Braun Schau
Peenemünder
Informationszentrum will an bewährtem Konzept festhalten und dennoch neue Wege
gehen. Dabei setzt es auf Multimedia.
Peenemünde (OZ) „Mit Physik hatte ich in der Schule nicht allzuviel am
Hut“, gesteht Christian Mühldorfer-Vogt mit einem entschuldigenden Lächeln. Und
er verspricht im gleichen Atemzug, dass er dieses Manko umgehend beheben will.
Schließlich, so der 45-Jährige, bis vor wenigen Tagen noch Leiter der
Städtischen Museen in Quedlinburg, könne vom Leiter des Historisch-Technischen
Informationszentrums Peenemünde (HTI) erwartet werden, dass er sich in
physikalischen Dingen zumindest etwas auskenne. Da nimmt sich der
frischgebackene HTI- Chef, der zum 1. Januar sein Amt antrat, selbst in die
Pflicht.
Das
naturwissenschaftliche Defizit dürfte allerdings bei weitem nicht das größte
Problem sein, mit dem sich der gebürtige Westfale in der kommenden Zeit
herumschlagen muss. Der Rückgang der Besucherzahl von 300 000 (2001) auf 240
000 im vergangenen Jahr stellt ihn und sein 25-köpfiges Team, zu dem 23
Angestellte und zwei Auszubildende gehören, zunächst vor die Aufgabe, diesen
Abwärtstrend zu stoppen. Dabei macht Mühldorfer-Vogt deutlich, dass er nichts
davon hält, Bewährtes über Bord zu werfen: „Das bisherige Gesamtkonzept des HTI
aus Bildung und Kultur, aus Denkmallandschaft und Museum ist hervorragend. Daran
möchte ich unbedingt festhalten.“
Der Leiter des Zentrums bekennt
sich ganz bewusst und aus innerer Überzeugung zu dem bislang Praktizierten.
Damit versucht er auch Befürchtungen in Zusammenhang mit dem Wechsel in der
HTI- Führung, die er vom langjährigen und anerkannten Museumsleiter Dirk Zacher
übernahm, zu zerstreuen: „Ich stehe für Kontinuität. Wir werden hier auch
künftig die Janusköpfigkeit dieser Stätte belegen, an der einerseits
Vernichtungswaffen entwickelt wurden und andererseits Voraussetzungen für den
Flug des Menschen ins All geschaffen wurden. Das zeigen wir zurzeit auf über
5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche unter dem Dach und auf 120 000
Quadratmeter Freifläche.“
Mühldorfer-Vogt belegt dieses
Bekenntnis auch mit Auszügen aus seiner Biografie. So wirkte der studierte
Sozialhistoriker am Aufbau der Gedenkstätte Schloss Holte-Stukenbrock bei
Bielefeldt, einem ehemaligen nationalsozialistischen Kriegsgefangenenlager, mit
und erforschte die Quedlinburger Stiftsgeschichte von Heinrich Himmlers SS.
Doch trotz des konsequenten Festhaltens an Erfolgreichem will Christian
Mühldorfer-Vogt, der sich auch auf dem Gebiet des Kulturmanagements
qualifizierte, unbedingt verändern und Neues wagen: „Wir müssen es schaffen,
uns als HTI noch besser zu vermarkten, ohne dabei Qualitätsverluste im Inhalt
der Ausstellungspräsentation hinzunehmen. Beides muss kein Widerspruch sein.“
Für ihn bedeutet dies durchaus
den Eventcharakter auszuprägen. „Ein Museumsbesuch soll bilden und auch Spaß
machen. Deshalb setze ich auf Multimedia, möchte den Besuchern
|
|
verschiedene Vermittlungsebenen
anbieten und sie mit interessanten, außergewöhnlichen Veranstaltungen anlocken.
Zu ihnen rechne ich die 2006 geplante Ausstellung über Wernher von Braun, zu
Nazi-Zeiten Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, ebenso wie eine
Exposition zum Thema Weltraum oder die Aufführung des Theaterstückes
„Kassandra“ nach Christa Wolf.“ Und er denkt auch an eine Museumsnacht, wie sie
in Quedlinburg und andernorts längst zum Erfolg wurde.
Dem HTI- Leiter schweben aber
vor allem Sonderaus-stellungen vor, die über einen längeren Zeitraum
präsentiert werden. Glanzstück einer solchen Exposition wird zweifellos die
historische Werkbahn, die bis 1945 in Peenemünde verkehrte und nach einer
Odyssee in Garmisch-Partenkirchen noch bis 1978 als S-Bahn verkehrte. Nun wird
sie an ihrem ursprünglichen Einsatzort bis 2008 teilweise originalgetreu
restauriert. Von ihrer Präsentation verspricht sich der Museumsmann große
Publikumsresonanz.
Verändern möchte Christian
Mühldorfer-Vogt weiterhin,
dass bisher praktisch nur Museum
und Gedenkstätte als Einheit existieren. Künftig gehe es ihm darum, diese
Bereiche um die geplante Denkmallandschaft mit einem historischen Lehrpfad im
25 Quadratkilometer großen Gelände zu erweitern, erklärt er. Von besonderer
Bedeutung sei es zudem, an dieser geschichtsträchtigen Stätte eine
internationale Jugendbegegnungsstätte zu schaffen.
,,Wir sind ein Eigenbetrieb der
Gemeinde Peenemünde und leben bislang von den Einnahmen aus Verkauf und
Eintritt. Bei rund zwei Millionen Euro laufende Kosten pro Jahr ist das
durchaus beachtlich“, betont der HTI- Leiter. Er macht jedoch kein Hehl daraus,
dass daran gedacht wird, das Museum ganz auf privatwirtschaftliche Füße zu
stellen. „Doch auch dann wird es an diesem Ort keinen Vergnügungspark geben.
Wir stehen zu unserer historischen Verpflichtung“, lässt er keinen Zweifel an
der Zukunft von Museum und Gedenkstätte.
Das HTI hat bis Ende März
dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Tel.: 03 83 71/50 50.
Internet www.peenemuende.de
WERNER GESKE
Ostseezeitung 10. Februar 2006
Trio restauriert S-Bahn-Wagen
Peenemünde Im HTI Peenemünde sind derzeit 20 ABM-Kräfte mit
Konservierungsarbeiten beschäftigt. Wie Projektleiter Hans Lieske informierte,
werden bis Juli außerdem die zwei S-Bahn-Wagen, frühere Werkbahn, durch drei
ABMer restauriert.
Ostseezeitung
Dienstag, 17. Januar 2006
Irdischer Besuch beim Eiszwerg
|
|
Heute startet die Nasa ihre Sonde „New
Horizons“ zum Planeten Pluto.
Washington (dpa) Der Planet Pluto, der Eiszwerg am Rand
unseres Sonnensystems, bekommt erstmals Besuch von der Erde. Heute soll die
Sonde „New Horizons“ der US-Weltraumbehörde Nasa vom Weltraumbahnhof Cape
Canaveral (Florida) zu einem mehr als neunjährigen und sechs Milliarden
Kilometer langen Flug aufbrechen. Wie bei einer Zeitreise fliegt der irdische
Raumkörper rund vier Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit – bis zu den
Anfängen unseres Sonnensystems. Nach Angaben der Nasa wird damit die
Ersterkundung aller neun Planeten abgeschlossen. Die Nasa spricht von einer Art
„astronomischer Archäologie“, weil Pluto eine unschätzbare Innenansicht der
Ursprünge unseres Sonnensystems biete. „Die Erforschung von Pluto und des
Kuipergürtels ist wie ein archäologischer Spatenstich in die Geschichte des
äußeren Solarsystems; ein Platz, wo wir in die vergangenen Zeiten der
Planetenbildung schauen können“, sagt Alan Stern vom Southwest Research
Institute in Boulder (Colorado).
Aber
auch aus einem anderen Grund ist Pluto für die Astronomen ein
„wissenschaftliches Wunderland“. Anders als andere Himmelskörper im so
genannten Kuipergürtel jenseits des Planeten Neptun hat Pluto beispielsweise
nicht nur einen Mond, sondern drei Trabanten. Dabei ist der Mond Charon so
groß, dass manche Wissenschaftler sogar von einem Doppelplaneten sprechen. Frühestens
im Juli 2015 fliegt „New Horizons“ in einer Entfernung von rund 10 000
Kilometern – einer kosmischen Winzigkeit - an Pluto vorbei. Fünf Monate lang
wird die Sonde den Planeten und dessen Mond Charon untersuchen.
Manchmal
wiegen Tage in der Raumfahrt ganze Jahre auf. Kann die Raumsonde beispielsweise
fristgerecht in einem Zeitfenster bis zum 3. Februar starten, wird sie Anfang
2007 am Planeten Jupiter vorbeifliegen und von dessen Schwerkraft wie von einem
Katapult in Richtung Pluto weitergeschleudert. Startet die Sonde etwa wegen
schlechten Wetters erst nach dem 3. Februar, wird die Reise ohne den
Schleudereffekt von Jupiter mindestens vier Jahre länger dauern.
Rund 700 Millionen Dollar
(580 Millionen Euro) lässt sich die Nasa den Flug in die weniger erforschten
Weiten am Rand unseres Sonnensystems kosten. Die Raumsonde hat etwa die Größe
eines Klaviers und wiegt 478 Kilo.
H. DAHNE
Ostseezeitung
Freitag, 20. Januar 2006
Nasa-Sonde „New Horizons“ zum Planeten Pluto gestartet
Cape Canaveral (dpa) Erstmals in der
Geschichte der Raumfahrt ist gestern eine Expedition zum Planeten Pluto am
Rande unseres Sonnensystems aufgebrochen. Die Nasa-Raumsonde „New Horizons“
startete um 20.00 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Die
Sonde soll die rund sechs Milliarden Kilometer lange Entfernung in neuneinhalb
Jahren zurücklegen.
Vereinsinformation
Als neues Mitglied in unserem Verein begrüßen wir recht
herzlich
Herrn Werner Kuffner, Neuhaus/ ObEck
Wir wünschen ihm viel Spaß und Freude bei einer erfolgreichen
Vereinsarbeit
![]()
Wir danken für die Spenden
Herrn Gademann, Walter 50
Euro
Herrn
Riedel, Hansgeorg 100
Euro
Frau Reimer, Margarete 50 Euro
Herrn
Stüwe, Botho 55
Euro
Frau Klar, Maria 50
Euro
![]()
In eigener Sache
Die Bankverbindungen unseres Vereins
Beitragskonto: 384 000 487
Spendenkonto: 384 001 432
Für beide Konten: Die Bankleitzahl:
150 505 00 Bank: Sparkasse Vorpommern
![]()

3.
KZ-Arbeitslager in
Peenemünde
Soweit bekannt, gab es auf
dem Peenemünder Gelände zwei KZ-Arbeitslager
(Für diese Lager gab es im Schriftverkehr sehr unterschiedliche
Bezeichnungen. In einem Dokument des KZ Buchenwald vom 07.08.1943 findet man
die Bezeichnungen Arbeitslager Carlshagen I und II[27], die auch heute
verwendet werden) Das Lager Karlshagen I
befand sich neben dem Gemeinschaftslager Ost. Dieses KZ-Lager bestand aus drei
Baracken, die um einen Appellplatz angeordnet waren, einem Waschhaus und einer
Küche. In jeder Baracke gab es 10-12 Zimmer, einen Waschraum und zwei
Toilettenräume. In jedem Zimmer standen Doppelstockbetten für 20-24 Häftlinge.
Der Barackenälteste hatte ein gesondertes Zimmer. In jedem Zimmer stand ein Ofen
für Braunkohlenbrikett (10 Stück pro Tag). Die Fenster hatten Holzläden, die
von außen verschlossen wurden.[9]
In diesem Lager befanden sich
männliche Häftlinge unterschiedlicher Nationalität (davon bekannt sind
Deutsche, Ukrainer, Russen, Holländer, Franzosen). Diese Häftlinge kamen aus
verschiedenen Konzentrationslagern. So kamen aus Buchenwald Ende Mai 1943 500 Häftlinge, im Herbst 1943 aus Natzweiler
350 und 1944 500 aus dem KZ Sachsenhausen.
Lagerkommandant war von Mai
1943 bis Juli 1944 der SS-Obersturmführer Hans Baumgarten. Ende 1944 wurde die
Bewachung des KZ-Arbeitslagers von Landesschützen übernommen. Kommandant war
dann ein Oberleutnant der Wehrmacht, der im Zivilleben Lehrer war.[15]
Nach der Ankunft im KZ
Arbeitslager Karlshagen erhielten die Häftlinge Holzschuhe, eine gestreifte
Hose, ein langes Hemd, Jackett, Mantel und Mütze. Die Nahrung bestand am Morgen
und Abend aus einer Tasse „Kaffee“-Getränk mit Sacharin, 200g Brot, Margarine
und Marmelade. Mittagessen gab es am Arbeitsort – Gemüsesuppe ohne Brot, wobei
der Inhalt auf dem Teller von der Person abhängig war, die die Suppe ausgab.
|
|
|
|
|
KZ-Arbeitslager Karlshagen I beim Gemeinschaftslager Ost |
|
Michail P. Dewjatajew (1968) |
Abends gab es 4 - 5 Kartoffeln , 200g Brot und Margarine.
Diese Verpflegung war nicht ausreichend und so hatten sie ständig Hunger. Der
Franzose Jan Fournier wog bei seiner Verhaftung 73 kg. Bei seiner Entlassung
aus dem KZ waren es noch 33 kg. Erschwerend für die Franzosen kam neben der
schweren körperlichen Arbeit das ungewohnte Klima dazu. Die Kälte im Winter
1944/45 machte ihnen schwer zu schaffen. [18]
Der Lagerführer ernannte
Häftlinge, zumeist Deutsche und Österreicher, zu Baracken- und Stubenältesten.
Deren Aufgabe war es, eine strenge Disziplin und Ordnung durchzusetzen. Sie
informierten die Lagerführung über alle Vorkommnisse in den Baracken. Auf Grund
dieser Meldungen wurden dann oftmals kranke und schwache Häftlinge durch die
Sanitäter mit einer Todesspritze ermordet. Gefürchtet waren bei den Häftlingen
auch die Morgenappelle. Durch den Lagerführer, in Begleitung von weiteren
SS-Männern, erfolgte hierbei eine Besichtigung der Häftlingskolonnen. Dabei
schlug er täglich einigen Häftlingen ohne Grund ins Gesicht. Besonders
schrecklich war für die Häftlinge der Befehl „zur Medizinkontrolle“, denn damit
waren die Häftlinge den Sanitätern ausgeliefert, deren Aufgabe es war, die Kranken
und Schwachen zu töten. [9]
Nach dem Appell übernahm
jeweils ein Wachsoldat eine Gruppe von 10 Häftlingen und marschierte mit ihnen
an die Arbeitsplätze. Sie wurden auf dem Flugplatz zu Erdarbeiten (Verlängerung
der Start- und Landebahn, Auffüllen von Bombentrichtern) sowie zu Hilfsarbeiten
im Bereich des Werkes West, z. B. zur Betankung und zum Tarnen der Flugzeuge
eingesetzt. Bei der Erprobung der Flügelbombe Fi 103 mußten die Häftlinge die
drei Zentner schweren Schußbolzen der Walter-Schleudern aus dem sumpfigen
Schilfgürtel bergen. Auch beim Entladen von Schiffen im Peenemünder Hafen kamen
sie zum Einsatz.
Ein besonderes Ereignis war
die Flucht des sowjetischen KZ-Häftlings Michael Dewjatajew und neun weiterer
Häftlinge mit einem Bombenflugzeug He 111 vom Flugplatz Peenemünde-West am
08.02.1945. Dewjatajew gelang es nach einigen Schwierigkeiten den Bomber zu starten
und sie flogen dann über die Frontlinie, die sich bereits kurz vor der Oder befand.
Beim Überqueren der Front wurden sie von der sowjetischen Flak abgeschossen.
Aber Dewjatajew gelang mit dem Flugzeug eine Notlandung, so dass alle die
Flucht unverletzt überlebten. [11]
Die Auflösung des Lagers
Karlshagen I begann Mitte Februar 1945. Am 13.02.45 trafen 922 Häftlinge aus
Peenemünde im Lager „Dora“ (Ellerich) ein. [17] Bereits am 18.02.1945 ging ein
weiterer Transport mit 351 Häftlingen zum
KZ-Außenlager Barth.
Laut Angaben ehemaliger
französischer Häftlinge ging am 28.03.45 ein Transport von rund 200 Häftlingen
nach Warnemünde und von dort weiter in das KZ Bergen-Belsen [18]
Eine weitere Gruppe von etwa
200 Häftlingen wurde Anfang April 45 mit der Eisenbahn in das KZ „Dora“ bei
Nordhausen transportiert. Nach 3-4 Tagen kamen sie dort an. Unterwegs starben
über 40 Häftling auf Grund der unmenschlichen hygienischen Zustände in den Waggons.
Nach einer Woche im Lager „Dora“ wurden die ehemaligen Peenemünder Häftlinge mit
einem Zug in ein Militärlager gebracht. Hier wurden sie von rumänischen
Soldaten bewacht. In den folgenden 3-4 Tagen kam es unter den Häftlingen zur
Lynchjustiz. Dabei wurden drei Barackenälteste, 8-9 Stubenälteste und die
freiwilligen SS-Spitzel ermordet. Das Wachpersonal hat bei diesen Vorgängen
nicht eingegriffen. Nach einer Woche übernahmen die sowjetischen Streitkräfte
das Lager. [9]
Ab Juni 1943 wurden auf
Anforderung der Peenemünder Betriebsleitung auch KZ-Häftlinge aus dem
KZ-Buchenwald in der Raketen-Serienproduktion eingesetzt. Laut dieser Anforderung
sollten zu Beginn 1400 berufsmäßig ausgesuchte Häftlinge in der Halle F1
arbeiten. Später war der Einsatz von insgesamt 2500 Häftlingen geplant. [5]
Der erste Transport traf am
17.06.1943 in Peenemünde ein. Er bestand aus 200 Häftlingen und 60
SS-Wachmannschaften. Die Häftlingsgruppe bestand je zur Hälfte aus Deutschen
und Russen. Am 11.07.1943 kam ein weiterer Transport mit 400 französischen
Häftlingen. Die Häftlinge wurden im Erdgeschoss der Halle F1 untergebracht und
mußten in der darüberliegenden Werkhalle arbeiten. Hier begann bereits am
16.07.1943 die Mittelteilfertigung für die Raketen. Andere Häftlinge mußten in
der sogenannten Russenwerkstatt im Sockelgeschoß Vorrichtungen herstellen. [22]
Die Errichtung eines
Barackenlagers auf dem freien Platz neben der Verwaltung des Versuchsserienwerkes
war vorgesehen, wurde aber nach dem englischen Bombenangriff auf Peenemünde
dann nicht mehr realisiert. Das KZ-Arbeitslager in der Halle F1 erhielt die Bezeichnung
Karlshagen II. (In einem Dokument
des Heimat-Artillerie-Park 11 Karlshagen aus dem Jahr 1943 wird dieses Lager
als „Häftlingslager F1“ bezeichnet [16]) Kommandoführer des Lagers war der
SS-Obersturmführer Arnold Georg Strippel. [22]
Das Lager existierte nur 4
Monate. Die Häftlinge wurden bereits am 13. Oktober 1943 in das KZ Dora bei
Nordhausen verlegt. [2]
Beide KZ-Arbeitslager in
Karlshagen waren dem KZ Ravensbrück unterstellt.
Über die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Häftlinge im KZ-Außenlager Karlshagen II sind folgende
Details bekannt. Die Aussage des ehemaligen Häftlings Willi Steimel findet man
in dem Buch „Die Rakete und das Reich“
von Michael Neufeld auf der Seite 229. Nach dieser Aussage waren die
Verhältnisse im Lager Karlshagen II, verglichen mit den sonst in den deutschen
Konzentrationslagern herrschenden Lagerbedingungen, sehr gut. „Die Einrichtungen waren ursprünglich für
deutsche Arbeiter gedacht und daher in einem guten und sauberen Zustand.
Angesichts der Tatsache, daß die relativ wenigen Häftlinge mit einer großen
Zahl von Zivilisten und Heeresangehörigen zusammenarbeiteten, hielten sich die
Schikanen und die Schläge der SS-Wachen in Grenzen, was, so Steimel, zu einer
„halbwegs erträglichen Lage“ geführt habe. ..... Die Halle F1 war jedoch
kein Erholungslager; üblicherweise mußten Häftlinge zu dieser Zeit an sechs
Tagen in der Woche täglich elf Stunden arbeiten. Steimels Aussage nach starben
während seiner viermonatigen Haft in Peenemünde drei Häftlinge an Tuberkulose
und zwei an Verletzungen; ein Häftling sei bei einem Fluchtversuch erschossen
worden und weitere vier seien gestorben, nachdem sie den mit Methanol
versetzten Alkohol-Treibstoff getrunken hatten.“ Beim Bombenangriff am 17./18.
August 1943 wurden 18 KZ-Häftlinge getötet und 60 verletzt.[1]
Der ehemalige Peenemünder
Häftling Godfried Elzenga berichtet über die Halle F1: „Im Erdgeschoß waren Schlafräume mit den üblichen Bettgestellen
eingerichtet, Aborte, einem Essenraum und sogar eine Krankenabteilung. Im ersten
Stock befand sich die Produktionshalle, wo unterschiedliche Maschinen zur
Metallbearbeitung aufgestellt waren. Uns wurden einige Drehbänke angewiesen, wo
uns die Fähigkeiten zur Herstellung von Verschlüssen gelehrt wurde. Es war
nicht schwierig.
Die Produktionshalle war
versehen mit einer halbrunden Dachbedeckung auf Stützpfeilern aus Eisenbeton,
die aus dem Fundament der Produktionshalle freistehend hervorragten.
Den ganzen Tag, mit Ausnahme der Mittagspause, standen
wir und drehten Verschlüsse, geisttötend und strapaziös. Eine kleine
Verschnaufpause wurde nicht eingelegt. So vergingen einige Wochen, ohne das
sich etwas besonderes ereignete, außer dass wir getroffen wurden durch den Tod
von Albert Spree (Häftlingsnummer 14849), der einem nicht zu stopfenden Durchfall
erlitt.
Die Produktionshalle wurde von einer Anzahl SS-Männer
überwacht. .........“ [14]
Über den Bombenangriff vom
17./18.08.1943 berichtet er: „Es stellte
sich heraus, dass kriminelle Häftlinge das nächtliche Durcheinander ausgenutzt
hatten, ...die politische Häftlingsführungsschicht zu ermorden und die Macht an
sich zu reißen.“ [14]
Die Berufsverbrecher
errichteten jetzt mit Duldung der Lagerführung eine brutale Herrschaft über die
anderen Häftlinge.
Nach dem Bombenangriff
erfolgte die Verlagerung der Serienfertigung in die unterirdischen Anlagen bei
Nordhausen. Die Häftlinge aus dem Lager Karlshagen II wurden am 13. Oktober
1943 in das Lager „Dora“ verlegt.
In einem Dokument aus dem
Archiv der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück [12] gibt es einen Hinweis darauf, daß
es in Peenemünde auch ein KZ-Arbeitskommando von etwa 300 Frauen gab. In den
Unterlagen wird aber nicht erwähnt, wo sich das KZ-Frauenlager in Peenemünde befand und welche Arbeiten diese
Frauen ausführen mussten.
Auch vom ehemaligen
Kommandant des VKN-Lagers, Hauptmann Wendt wurde 1993 über solch ein
Frauenlager berichtet. Er war nicht nur für die Soldaten im VKN-Lager verantwortlich,
sondern auch für das Barackenlager, in dem die weiblichen KZ-Häftlinge
untergebracht waren. Dieses Lager befand sich im Jahre 1944 im RAD-Lager
Karlshagen, in der Peenestraße. Die Bewachung der Häftlinge erfolgte durch
Wehrmachtsangehörige.
Über die Anzahl der
Häftlinge, die in Peenemünde ihr Leben verloren, gibt es keine eindeutigen
Angaben. Es existiert eine Liste, erstellt im Jahre 1967 von einer
Forschungsgruppe in Schwerin. In dieser Liste werden 171 Namen von Häftlingen
aus Peenemünde aufgeführt, wahrscheinlich aus dem Lager Karlshagen I, die im
Krematorium Greifswald von Dezember 1943 bis September 1944 eingeäschert wurden.
An der südlichen Mauer des
Friedhofes Peenemünde wurde in den sechziger Jahren ein Massengrab mit 56 Toten
gefunden. Einige von ihnen wurden durch einen Kopfschuß getötet. Die Identität
dieser Toten ist aber nicht eindeutig geklärt. Es wird angenommen, daß es sich
ebenfalls um KZ-Häftlinge handelt.
Anhand der im Text bereits
erwähnten Opfer und diesen konkreten Angaben kamen damit insgesamt 255
KZ-Häftlinge in Peenemünde ums Leben. Da über die anderen Zeiträume keine
Unterlagen vorhanden sind, kann man nur vermuten, daß die Zahl der Opfer insgesamt
weit höher liegt.
Nach dem Kriege wurden diese
Fakten von einigen ehemaligen Peenemündern verdrängt und sie behaupteten, dass
es in Peenemünde keine KZ-Häftlinge gab. Diese Behauptungen werden nicht nur
durch die Erlebnisberichte der Häftlinge sondern auch durch die vorhandenen Dokumente
widerlegt. Der Oberst Dornberger selbst informierte die Peenemünder
Gefolgschaft beim Betriebsappell am 18.06.1943 in der Halle F1 über die Anwesenheit
der KZ-Häftlinge. Bei diesem Appell, an dem 5000 Personen teilnahmen, belehrte
er sie in seiner Ansprache unter Punkt 26:
„Das 4. Kriegsjahr bringt es mit sich, dass wir jetzt außer deutschen Soldaten,
Angestellten und Arbeitern hier in Peenemünde mit dem Einsatz von Ausländern,
K.Z.-Häftlingen und Gefangenen zu rechnen haben. Halten Sie Abstand von den
Gefangenen und ausländischen Arbeitern. Arbeiten Sie ihnen vor, zeigen Sie
ihnen, was ein Deutscher kann. Aber schikanieren Sie die Leute nicht.“[29]
Diese Abhandlung soll einen
Beitrag zur weiteren Aufarbeitung der Peenemünder Geschichte sein, denn es gibt
immer noch sehr viele Unklarheiten gerade über die Arbeits- und Lebensbedingungen
der ausländischen Arbeitskräfte, der Kriegsgefangenen und KZ- Häft-
linge. Die Darstellung beruht
ausschließlich auf Aussagen von Zeitzeugen und Originaldoku-menten sowie
Zitaten aus Veröffentlichungen zu diesem Thema.
Quellen:
[1] Die Rakete und das Reich, Michael Neufeld, Berlin 1997, S. 156
[2] Die Rakete und das Reich, Michael Neufeld, Berlin 1997, S. 228
[3] Briefwechsel des HTI mit dem polnischen Arbeiter Leon Dropek, Archiv HTI
[4] In
deutscher Kriegsgefangenschaft, Michael Klimenko aus dem Buchmanuskript „Ein
Blick von unten her – Erlebnisse eines russischen Soldaten in
deutschen Kriegsge-
fangenenlagern 1942-1945“, Archiv HTI
[5] Aktenvermerk
über die Besprechung beim A4-Ausschuß (Arbeitseinsatz) am 02.06.1943 in Berlin
(Lokomotivhaus) , Archiv HTI EC/ 73
[6] Zwangsarbeiter in Peenemünde (1939 – 1945): Praxis und Erinnerung, Jens-Christian
Wagner in Zeitgeschichte Regional - Mitteilungen aus Mecklenburg- Vorpommern Heft 1 / Juli 2000, S.
15-21
[7] Postkarte
an den Tschechen Waclav Fröhlich von 1942, Archiv HTI
[8] Marie ter Morsche kann ihren Vater nicht vergessen, Karl Heinz Jahnke, Rostock 2001
[9] Briefwechsel des HTI mit dem ukrainischen
KZ-Häftling Wladimir Kolesnick, Archiv HTI
[10] Gesprächsprotokoll mit Herrn Edward Seder vom
30.09.1997, Harald Tresp , Archiv HTI EC/ 73
[11] Gesammelte Informationen über die Flucht des KZ-Häftlings Dewjatajew, Archiv HTI
[12] Kopien von Unterlagen aus dem Archiv der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück, Archiv HTI
[13] Angaben nach Zeichnungen und Informationen vom ehemaligen Adjutanten Oberleutnant Kurt Born-
träger (Verantwortlicher für die sowjetischen Kriegsgefangenen in Peenemünde), Archiv HTI
[14] Die misslungene Englandfahrt - Erlebnisbericht des niederländischen DORA-Häftlings Godfried
Elzenga, vom Dezember 1996, Archiv HTI
[15] Brief von Dr. Dieter Lange (Sohn des Chefs der Verwaltung in Peenemünde-West, Johannes Lange) an
H. Tresp über seine Erlebnisse als Jugendlicher in Peenemünde, 1992, Archiv HTI EC/73
[16] Niederschrift über die Besprechung in Karlshagen am 25.08.1943, Seite 4, Archiv HTI
[17] Produktion des Todes – Das KZ Mittelbau-Dora; Jens-Christian Wagner, S. 645
[18] Bericht von zwei ehemaligen französischen KZ-Häftlingen aus dem Lager Karlshagen I,
Peenemünde 16.06.2004, Archiv HTI
[19] Aufstellung der Arbeitskräfte der Elektromechanischen Werke GmbH 19.08.1944, Archiv HTI
Ordner zur Ausstellung 6.1.2
[20] Archiv HTI, Ordner zur Ausstellung 6.5.2
[21] Arbeiterunterbringung in Peenemünde vom 21.06.1940, Archiv HTI, Ordner zur Ausstellung 6.5.3
[22] Entstehungsgeschichte des
Versuchsserienwerkes Peenemünde, Band
V, 1943, S. 19, Archiv HTI
[23] Aktennotiz über die Besprechung in Peenemünde am 9.-11.5.40, 15.05.1940 S. 3; Archiv HTI
[24] Fremdarbeiter:
Politik und Praxis des
„Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten
Reiches; Ulrich Herbert, Bonn 1999, S. 282ff
[25] Erfahrungsbericht über die Bombennacht vom 17. zum 18.08.43; Ing. Walter Reuß an die Werkdirek-
tion Süd vom 30.08.1943, Archiv HTI
[ 26] Brief des Ingenieur Walter Petzold zur Erforschung der Geschichte des EV Rostock, 1966, Archiv
HTI F16/2
[27] Anschreiben des K.L. Buchenwald an den 1. Lagerarzt FKL. Ravensbrück, vom 07.08.1943, Archiv
HTI Ordner Ausstellung 6.4.9
[28] Entstehungsgeschichte des Versuchsserienwerkes Peenemünde, Band I, 1939, S. 27, Archiv HTI
[29] Rede Oberst Dornberger beim Betriebsappell am 18.06.1943, Archiv HTI
[30] Peenemünde - Mythos und Geschichte der Rakete 1923 – 1989, Katalog des Museums Peenemünde,
S. 366
Fotos und Zeichnungen, Archiv HTI Peenemünde
Manfred Kanetzki
Aus Magazin P:M: Januar
2006
EXPERIMENT
AKTUELL: DIE ARIANE 5

|
SILVESTER-GAG
Den Fallschirm noch verstauen, dann geht das 53 Zentimeter große Ariane-Modell an den Start |
Cape Canaveral auf der grünen
Wiese
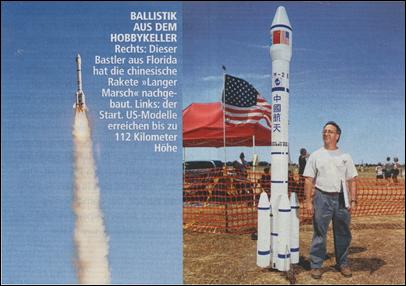 EINMAL SELBST eine Rakete bauen und
abschießen - das ist mit dem Bausatz Ariane 5 der Firma Noris Raketen möglich.
Die 124 Gramm leichte ESA-Rakete erreicht hundert Meter Höhe. Nach 90 Minuten
Bastelzeit geht's an den Start (eine Genehmigung dafür wäre erst ab 300 Meter
Steighöhe erforderlich). Der Motor ist mit zwölf Gramm Schwarzpulver gefüllt,
denn Gewicht, Steigzeit und Steighöhe erfordern eine Schubkraft von 5,85
Newton. Das Pionier- und Glücksgefühl des P.M.-Experimentators Michael Stang
ist heftig - aber kurz. Der Start gelingt. Senkrecht und mit viel Rauch und
Getöse jagt die 53 Zentimeter hohe Ariane 5 in den Himmel. Nach gut zwei
Sekunden erreicht sie ihren Gipfelpunkt, und der Fallschirm entfaltet sich, an
dem der Flugkörper zur Erde zurückschwebt. Deutsche Hobbybauer finden auf dem
Markt vierzig unterschiedliche Modelle, die bekannte amerikanische und
russische Raketen nachstellen. Sie sind maximal 1,40 Meter lang und kosten bis
zu 300 Euro. Die Kosten für den Ariane-Bausatz: 62,40 Euro. Wer ganz hoch
hinauswill, muss in die USA reisen, wo Raketenmodelle vier Kilometer Flughöhe
erreichen dürfen und auf fast 500 km/h
Geschwindigkeit beschleunigen. Dort gibt es nicht nur viel größere
Bausätze, sondern auch raffinierte Eigenkonstruk-tionen, die mit
Hybridantrieben fliegen, bei denen Plastik mit Stickoxid oxidiert wird.
Übrigens: Der Höhenrekord in den USA liegt bei 112 Kilometern! Ein sieben Meter
langer und 350 Kilogramm schwerer Eigenbau entfloh 2004 der Erdgravitation und
erreichte das Weltall. US Raketenbastler stecken so viel technisches Know-how
in Motoren, Flugtechnik und Design, dass bei großen Flugtagen auch
Raumfahrtingenieure und NASA-Vertreter gesichtet werden, die nach neuen Ideen
für die Raketentechnik von morgen Ausschau halten.
EINMAL SELBST eine Rakete bauen und
abschießen - das ist mit dem Bausatz Ariane 5 der Firma Noris Raketen möglich.
Die 124 Gramm leichte ESA-Rakete erreicht hundert Meter Höhe. Nach 90 Minuten
Bastelzeit geht's an den Start (eine Genehmigung dafür wäre erst ab 300 Meter
Steighöhe erforderlich). Der Motor ist mit zwölf Gramm Schwarzpulver gefüllt,
denn Gewicht, Steigzeit und Steighöhe erfordern eine Schubkraft von 5,85
Newton. Das Pionier- und Glücksgefühl des P.M.-Experimentators Michael Stang
ist heftig - aber kurz. Der Start gelingt. Senkrecht und mit viel Rauch und
Getöse jagt die 53 Zentimeter hohe Ariane 5 in den Himmel. Nach gut zwei
Sekunden erreicht sie ihren Gipfelpunkt, und der Fallschirm entfaltet sich, an
dem der Flugkörper zur Erde zurückschwebt. Deutsche Hobbybauer finden auf dem
Markt vierzig unterschiedliche Modelle, die bekannte amerikanische und
russische Raketen nachstellen. Sie sind maximal 1,40 Meter lang und kosten bis
zu 300 Euro. Die Kosten für den Ariane-Bausatz: 62,40 Euro. Wer ganz hoch
hinauswill, muss in die USA reisen, wo Raketenmodelle vier Kilometer Flughöhe
erreichen dürfen und auf fast 500 km/h
Geschwindigkeit beschleunigen. Dort gibt es nicht nur viel größere
Bausätze, sondern auch raffinierte Eigenkonstruk-tionen, die mit
Hybridantrieben fliegen, bei denen Plastik mit Stickoxid oxidiert wird.
Übrigens: Der Höhenrekord in den USA liegt bei 112 Kilometern! Ein sieben Meter
langer und 350 Kilogramm schwerer Eigenbau entfloh 2004 der Erdgravitation und
erreichte das Weltall. US Raketenbastler stecken so viel technisches Know-how
in Motoren, Flugtechnik und Design, dass bei großen Flugtagen auch
Raumfahrtingenieure und NASA-Vertreter gesichtet werden, die nach neuen Ideen
für die Raketentechnik von morgen Ausschau halten.
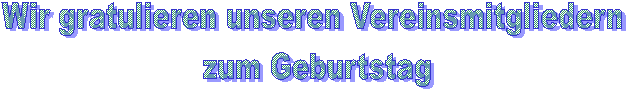

Im Januar hatten
Geburtstag
|
|
|
|
|
|
Herr Rainer Adam, Karlshagen |
|
|
Frau Elsbeth Ost, Bad Kreutznach |
|
|
Frau Römpagel Brigitte, Karlshagen |
|
|
Frau Dr. Mechthild Wierer, Berlin |
|
|
Herr Christoph Beyer, Berlin |
|
|
Herr Günter Koch, Peenemünde |
|
|
Herr Dr. Hans - Eberhard Bauer, Pasewalk |
|
|
Herr Dr. Dieter Genthe, Bonn |
|
|
Herr Thorge von Ostrowski, Tellingstedt |
|
|
Frau Erika Roguschak, Schwerte |
|
|
Herr Ernst Kütbach, Köln |
|
|
Herr Norbert Nitzke,Revensdorf |
|
|
Frau Auguste Friede, Duisburg |
|
|
Herr Frank Giesendorf, Berlin |
|
|
Herr Hansgeorg Riedel, Braunschweig |
|
|
|
|
Im Februar hatten
Geburtstag
|
Im März haben Geburtstag |
|
|
|
|
Frau Ruth Kraft-Bussenius, Zeuthen |
Herr Ronald Abraham, Insel
Kos |
|
Herr Wilhelm Doletschek, Salzgitter |
Frau Waltraud Müller, Fassberg |
|
Herr Nils Steinmann, Osterholz-Scharmbeck |
Herr Jürgen Bütehorn, Kaarst |
|
Frau
Rike Riedel-Lückmann, Hintersee |
Herr Jürgen Bergemann, Rehagen |
|
Herr Dieter Frenzel, Karlshagen |
Frau Margot Kunstfeld, Fürth |
|
Herr
Dr- Ing. Przybilski, Olaf, Dresden |
Herr Werner Seipenbusch, Velbert Langenberg |
|
Frau Käthi Peters, Uedern |
Frau Liselore Bethge, Helmstedt |
|
|
Herr Lutz Hübner, Karlshagen |
|
|
Frau Dr. Rita Habicher, Berlin |
|
|
Herr Dr. Dieter Lange, Nübbel |
|
|
Herr Sartor, Hans, Leer |
|
|
Herr Joachim Saathof, Karlshagen |
|
|
Herr Adolf Frank, Hardthausen |
|
|
Herr Prof. Dr. Günter Brittinger, Essen |
![]()
Impressum
Herausgeber:
Verein zur ,,Förderung und Aufbau eines Historisch-Technischen Museums
Peenemünde -Geburtsort der
Raumfahrt"
e.V., Peenemünde
Anschrift:
Förderverein Peenemünde e. V. Am
Maiglöckchenberg 21 17449 Karlshagen
Tel./Fax:
038371/25479 (mit Anrufbeantworter)
e-mail: fvpeenemuende@aol.com
Homepage: www.foerderverein-peenemuende.de
Gestaltung:
Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen
Layout und
Druck: G. Helm, Norderstedt
Alte
Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch
Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks,
vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht
gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den
gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk
vervielfältigt.