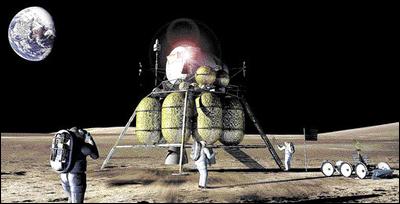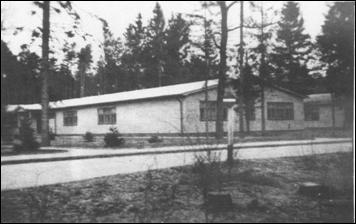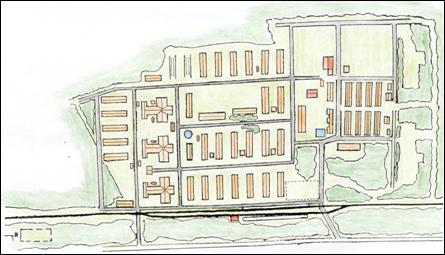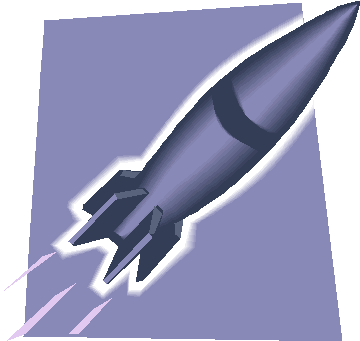

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern
und Freunden des Vereins
schöne und besinnliche Feiertage sowie
ein erfolgreiches Jahr 2006 bei bester
Gesundheit.
Jahreshauptversammlung des
Fördervereins Peenemünde e. V.
Wie
geplant, fand am Sonntag, dem 25.09.05, im Hotel Baltic in Zinnowitz die
Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins Peenemünde e. V. statt. Anwesend
waren 20 Mitglieder und eine Reihe von Gästen, so u. a. der Bürgermeister von
Peenemünde, Herr Barthelmes.
Den
Bericht des Vorstandes verlas unserer Vereinsvorsitzender, Herr Volkmar
Schmidt.
|
|
|
|
Jahreshauptversammlung
2005 |
Foto
L.Hübner |
Hier
wurde eingeschätzt, dass die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Leiter des HTI,
Herrn Zache, auch 2004/2005 stagnierte. Die Vorschläge des Vorstandes für eine
Vereinbarung über eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen HTI und Verein, die
Herrn Zache übergeben wurde, blieb ohne Reaktion. Im Hinblick auf den neuen
Leiter des HTI wünschen wir uns eine vernünftige Zusammenarbeit. Im Bericht
wurde deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die mit dem Ausscheiden von Herrn
Zache einsetzende Polemik in den Printmedien und im Internet unnötig war. Eine
an Personenkult grenzende Überbewertung der Leistungen des Herrn Zache war für
uns unverständlich.
In
Bezug auf das HTI wurde deutlich gemacht, dass der bisherige Ausstellungsteil
eine gelungene Widerspiegelung der Anfänge, Hintergründe und Folgen der
Entwicklungen in Peenemünde ist. Im zweiten Ausstellungsabschnitt sind noch
Vitrinen leer. Vermisst wird eine ausführliche Darstellung der Entwicklungen in
Peenemünde und des Werkes West. Die Erprobungsstelle der Luftwaffe wird gar
nicht erwähnt.
Im
Gegensatz zu Meldungen in der Presse über steigende Besucherzahlen im HTI, ist
in Wirklichkeit ein stetiger Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.
Befragungen und Gespräche mit Besuchern machte deutlich, dass seit der
Neueröffnung des Museums keine Erweiterung und Vervollständigung der
Ausstellung erfolgte. Es fehlt etwas Neues, was den Stammbesucher wieder ins
HTI lockt. Sonderausstellungen und
Veranstaltungen, die Herr Zache organisiert hat, haben mehr Kosten als Nutzen
gebracht.
Am
Schluss seiner Ausführungen schlug der Vereinsvorsitzende im Namen des
Vorstandes vor, Herrn Reinhold Krüger als Ehrenmitglied unseres Vereins zu
ernennen. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt. Die Ernennungs-urkunde
erhält seine Tochter.
Im
Mittelpunkt der anschließenden Beratung und eines regen Gedankenaustausches
standen Fragen der inhaltlichen Gestaltung der Arbeit des Vereins in Bezug auf
die weitere Darstellung der Peenemünder Geschichte. In der Diskussion wurde zum
Ausdruck gebracht, dass besonders eine enge Zusammenarbeit mit dem HTI allen
Vereinsmitgliedern am Herzen liegt. Dafür ist ein zukunftsweisendes Konzept
notwendig, dass weitere Kontinuität in die Museumsarbeit bringt. Aus dieser
Sicht wollen wir mit der Gemeinde Peenemünde und dem neuen Leiter des HTI
sachlich, fachgerecht und zukunftsorientiert zusammenarbeiten für ein neues
Museumsabenteuer.
Der
Vorstand
Förderverein
Peenemünde e. V.
Reinhold Krüger Ehrenmitglied unseres Vereins
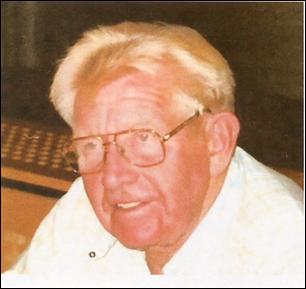 Wie schon berichtet, wurde Reinhold Krüger auf unserer Jahreshauptversammlung ein-stimmig
postum zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.
Wie schon berichtet, wurde Reinhold Krüger auf unserer Jahreshauptversammlung ein-stimmig
postum zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.
Reinhold Krüger
hat sich große Verdienste um die Erforschung der Peenemünder Geschichte von
1936 1945 erworben. Als langjähriges Vereins- und Vorstandmitglied leistete
er eine zielstrebige und gründliche Arbeit. Immer war er ansprechbar für alle
ehrlichen Interessenten der Peenemünder Geschichte. Wir haben mit seinem Tod
einen wichtigen Mitarbeiter verloren.
Reinhold Krüger bleibt uns für immer in guter Erinnerung. Wir wollen sein Werk
fortsetzen und ihm mit dieser Ehrenmitgliedschaft ein bleibendes Denkmal
setzen.
Ostseezeitung 21.09.2005
NASA plant
Basislager auf dem Mond
Vom
Mond aus will die NASA zu Flügen zum Mars starten. Deshalb plant die Behörde
die Rückkehr zum Erdtrabanten.
Washington (dpa) Die
US-Raumfahrtbehörde NASA zieht es wieder richtig in die Ferne, und die
internationale Raumstation ISS ist dafür einfach nicht weit genug weg. Deshalb
gibt es ab 2018 wieder einen Mann auf dem Mond, der neuen NASA-Weltraumfiliale.
Zuerst werden zwei Mal im Jahr jeweils vier Astronauten einen einwöchigen
Schnupperkurs auf dem Erdtrabanten absolvieren. Später wird die Crew alle sechs
Monate gewechselt.
Bevor die NASA-Astronauten jedoch in drei Tagen Entfernung von der Erde ihren Außenposten beziehen, werden erst einmal die Pfadfinder vorgeschickt: In drei Jahren sollen die ersten Roboter über die Mondoberfläche zuckeln und erkunden, was sich für das Basislager und weitere Abenteuer im Weltall alles verwenden lässt.
NASA-Direktor Michael Griffin hat es vor allem der Südpol angetan, weil dort Wasserstoff in gefrorenem Eis vermutet wird. Außerdem gibt es dort reichlich Sonnenlicht für die Energieversorgung.
Gemini, Apollo, Space-Shuttle alles klangvolle Namen im Vergleich zum neuen Raumgleiter, dem Crew Exploration Vehicle. Schon in sieben Jahren soll die nach der
Abkürzung (CEV) si-i-vi ausgesprochene Raumfähre durch das Weltall navigieren. Wartungsflüge zum alternden Weltraumteleskop Hubble, Versorgungsflüge zur ISS? Alles kein Problem für Griffin. Nach dem ersten Flug zum Mond in 13 Jahren soll die Raumfähre später vom Erdtrabanten aus die 500 Tage lange Reise zum Mars antreten.
|
|
Der NASA-Direktor gerät schon jetzt ins Schwärmen und beschreibt den neuen Raumgleiter als eine Apollo-Kapsel auf Steroiden. Das Gefährt ist drei Mal größer als Apollo, hat einen Durchmesser von 5,5 Meter und bietet auf Langzeitflügen zum Mars Platz für sechs Astronauten. Bei der Rückkehr zur Erde bremsen drei Fallschirme den Aufprall. Anschließend tauschen Techniker das Hitzeschild einfach aus, und schon kann es zum nächsten Flug zum Mond gehen. Auch beim Treibstoff denkt Griffin in der Zukunft. Raumgleiter und Mondlander werden mit Flüssigmethan angetrieben.
Im Prinzip kann sich Griffin mit seinen Mondplänen auf der Sonnenseite wähnen. Wenn nur nicht die Finanzierung wäre. Rund 104 Milliarden Dollar (86 Milliarden Euro) kostet die Rückkehr zum Mond, den im Dezember 1972 Harrison Schmitt als zwölfter und vorläufig letzter Mensch betreten hatte.
Der Weg zum Mars neue Pläne der USA
Von 1969 bis 1972 betraten
zwölf US-Astronauten den Mond. Jetzt soll der Mond nach Vision von Präsident
Bush als Sprungbrett zum Mars dienen. Die europäische Raumfahrtagentur ESA hat
ihr Interesse bekundet. Die Europäer starteten schon 2002 das Programm Aurora,
das zunächst unbemannte Flüge zum Mond und Mars vorsieht und gegen 2030
Menschen zum Roten Planeten bringen soll.
Ist
das realisierbar? Kann ein Mensch so
lange im All unterwegs sein?
Der Kosmonaut, Prof. Dr. Valery Poljakow, Arzt, Jahrgang 1942, stellv. Direktor des Instituts
für medizinische Probleme in Moskau untersuchte bei Langzeitflügen das Verhalten
des Menschen im All.
Er
war selbst mit dem Raumschiff MIR im All unterwegs:
24. August 1988 27.
April 1989 =
8 Monate
08. Januar 1994 22.
März 1995 =
438 Tage
In
einem Vortrag auf einer Konferenz der TH Mittweida äußerte sich Valery Poljakow
zu dem Problem des Langzeitfluges.
Er
nannte vier wesentliche Belastungen für den Körper:
·
die
Herzmuskulaturdehnung,
·
die Gefäße werden
durch die vertikale Lage nicht trainiert,
·
die Muskeln
atrophieren und
·
die Knochen
verlieren Calcium.
Schon
14 Tage im All wirken sich ungünstig aus. Deshalb ist eine zielgerichtete
Gesundheits-vorsorge im Raumschiff notwendig durch: Laufband, Fahrrad,
Expander, Saughose sowie durch einen Anzug mit längsverlaufenden Gummibänder
zur Simulation der Schwerkraft.
Poljakow
bereitete sich 19 Jahre auf seinen Raumflug vor und meldete sich für einen
Langzeitflug von 1 ½ bis 2 Jahren als Test für den Marsflug. Als seine Aufgabe
sah er in der Überwachung seines Körpers und der Gesundheit seiner Kameraden.
Er gab Ratschläge für die richtige Verpflegung. Außerdem stellte er fest, dass
bei geringer körperlicher Belastung in der Schwerelosigkeit weniger Sauerstoff
benötigt wird. Gegen den Widerstand des Flugleitzentrums setzte er eine
Reduzierung des Sauerstoffs in der MIR -Atmosphäre durch. Auch danach blieben
alle Werte normal.
Valery
Poljakow sagte, dass er während des Fluges viel dazu gelernt habe, auch, dass
ein Aufenthalt in der Schwerelosigkeit über ein Jahr möglich ist.
Man
rechnet mit einer mittleren Flugdauer zum Mars und zurück von 500 Tagen. Der
Marsflug ist abhängig vom Marsfenster, das ist das Datum des geringsten
Abstandes des Mars von der Erde und von der Sonnenaktivität.
Bei
seinem 2. Flug hatte Poljakow ca. 900 medizinische Experimente durchzuführen.
Außerdem führte er Messungen der kosmischen Strahlung durch. Noch 10 Jahre lang
nach dem Flug kontrollierte er deren Auswirkungen auf seinen Körper. Seine
eigene Verfassung war besser als die der anderen, infolge seines intensiven
Trainings. Täglich ist er 18 Minuten gelaufen und 25 km mit dem Rad gefahren.
Interessant
war, dass sich Valery Poljakow dazu geäußert hat, welcher Personenkreis einen
Langzeitflug auf sich nehmen sollte. Er sagte: Man soll keine jungen Leute zum
Mars schicken, eher ältere Erwachsene. Erstens wegen der Gefahren und zweitens
wegen der sterilisierenden kosmischen Strahlung. Man soll Erwachsene
bevorzugen, die psychisch auf die Gefahren vorbereitet sind und bereits Kinder
oder sogar Enkel haben. Außerdem könnten ältere Erwachsene politisch glaubhafter
für die Raumfahrt plädieren.
Poljakow
nannte sein Planungsmodell:
2040 Orbitalflug um den Mars ohne
Landung. Kosten: 15 Milliarden Dollar
2080 Landung technisch möglich. Kosten: 25
Milliarden Dollar
Russland
hat trotz der Entwicklungsschwierigkeiten die notwendigen Mittel, wenn die
Raumfahrtländer mitarbeiten.
Weiterhin
nannte er einige technische und organisatorische Einzelheiten.
Seiner Meinung nach reicht ein Raumschiff mit
etwa 500t Gewicht für drei Passagiere. Einzelne Module, die zum Raumschiff
zusammengebaut werden müssen, können von PROTON-Raketen zu einer Orbitalstation
über der Erde hochgeschossen und dort montiert werden.
Gegen
die Strahlungsgefahr könnte man die Wasservorräte in der Peripherie, an der
Wand des Raumschiffes lagern. Ebenso das flüssige Xenon für den thermonuklearen
Antrieb.
Die
Nahrungsbehälter aus Aluminium könnte man innen lagern und die geleerten
Behälter zur Raumgewinnung zusammenpressen und in den Raum entsorgen.
Als
Besatzung empfehlen sich Amerikaner, Europäer und Russen. Wie schon erwähnt,
empfiehlt Poljakow nur drei Personen fliegen zu lassen. Schon vier Personen
erfordern ein wesentlich größeres Raumschiff, eventuell von doppelter Größe.
Später sollten Raumschiffe mit 6 Personen fliegen.
Er
hat auch den Bedarf für den Unterhalt ausgerechnet:
Für 6 Mann für 500 Tage = 58.830 Tonnen Täglicher Bedarf = 117,66 kg
Wasser 50.700 101,4
Trinkwasser 7.500 15,0
Waschwasser 13.500 27,0
Launddry
(Wäscherei) 21.000 42,0
Technisch 1.800 3,6
Pflanzenwässern 900 1,8
Reinigung 6.000 12,0
Sauerstoff 2.880 5,76
Nahrung 5.250 10,5
Summe 58.830 117,66
Die Frage ist noch, ob eine gemischte Mannschaft mit Frauen von Vorteil ist.
Religiöse
Dissonanzen sind bei den Mannschaften bisher nicht aufgetreten. So z. B.: Russ.
orthodoxer Poljakow röm. kathol. Merbold und muslimischer Muoussabaiev
harmonierten miteinander. Die gemeinsame Idee, die Motivation muss stimmen.
Biologisch
ist der Marsflug möglich, es hängt nur noch von den Ingenieuren und den
Finanzen ab.
Zum
Abschluss noch eine kleine Anekdote:
Poljakow
träumt davon die Marsmission noch selber mitzumachen. Seine Frau sei
einverstanden. Er habe den 78-jährigen John Glennen gefragt: Möchtest du mit
zum Mars
fliegen?
Da habe dieser zu seinem Erstaunen und zu seiner Genugtuung gesagt: Mit dir
sofort!
Das
sind die Visionen eines russischen Raumfahrers. Die Deutschen stehen wieder mal
dabei abseits. Die ehemalige Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn hat
sich gegen bemannte Allmissionen ausgesprochen, will allein auf Roboter setzen.
Der uns gut bekannte NASA-Planungsmanager, Jesco von Puttkammer, sagte dazu:
Deutschland ist enorm rückwärts gewandt. Ich sehe überall Museen, aber keine
Visionen für die Zukunft. (Sollte man ev. auch für den weiteren Ausbau der
Ausstellungen im HTI berücksichtigen)
Vielleicht
ändert ja die neue ALL-MACHT etwas. China brachte im Oktober 2004 den
Astronauten Yang Liwei und im Oktober 2005 die zwei Astronauten Fei Junlong
und Nie Haisheng in die Erdumlaufbahn.
Stern 15.10.2005
Das "Magische Schiff" fliegt ins All
|
|
|
Der Start von Shenzhou VI verlief ohne Probleme Foto:Reuters |
Mit dem zweiten Start eines bemannten
Raumfluges hat China seinen Anspruch als Weltmacht deutlich gemacht. Im All
sollen die beiden Astronauten die lebenserhaltenden Systeme der "Shenzhou
VI" testen, aber das Raumschiff auch verlassen.
Aufstrebende
Weltmacht
|
|
|
Die chinesischen Taikonauten Fei Junlong (l.) und Nie Haisheng sollen fünf Tage im All verbringen Foto: Reuters |
"Wir fühlen uns ganz gut",
funkte Fei aus dem All. Ministerpräsident Wen hatte die Astronauten, die in
China "Weltraumreisende", Taikonauten, genannt werden, kurz vor dem
Start besucht. Das Raumschiff erreichte nach 23 Minuten seine Umlaufbahn. Wei
sagte: "Shenzhou 6, die weltweite Aufmerksamkeit erregt hat, ist
erfolgreich gestartet." Das Abheben der Rakete "Langer Marsch"
vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi wurde erstmals im Fernsehen
übertragen, was die Zuversicht der chinesischen Führung in die Zuverlässigkeit
der Technologie demonstrierte.
Jubelnde
Schulkinder verfolgten den Start im Klassenzimmer. Peking will mit seinem
Raumfahrtprogramm seinen Anspruch als aufstrebende Weltmacht untermauern und
patriotische Gefühle schüren, die das Ansehen der Kommunistischen Partei
aufpolieren sollen. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, die
Astronauten sollten während ihres Fluges ihre zehn Kilogramm schweren
Raumanzüge ausziehen, um zwischen den beiden Hälften ihres Raumschiffs - einer
Landekapsel und einem Orbiter - zu wechseln.
Sitzungen des Vorstandes
In unserem Infoblatt 3/2005 gedachten wir unseres verstorbenen
Mitgliedes, des Flugbaumeister Dipl.-Ing. Max Mayer.
Anlässlich seines Ablebens am 17. Juli 2005, haben viele gute Freunde und Bekannte der Familie Mayer
statt Blumen und Kränze Geld für unseren Verein gespendet.
Max
Mayer selbst war vom
11. Dezember 1938 bis Mai 1945 als Versuchspilot und Leiter E2 in Peenemünde
West tätig.
Wir denken, dass es im Sinne von Max Mayer wäre, wenn wir die Spendensumme von
- 3157
EUR -
für den Aufbau einer Ausstellung über Peenemünde West
einsetzen.
Vielen Dank allen Spendern und ins besonders seiner
Ehefrau, Frau Rita Mayer-Schoen.
œ Wir gedenken unseres
verstorbenen Mitgliedes
Jutta Orlowski
* 24.11.1919 04.09.2005
Sie nimmt in unserer Erinnerung einen festen Platz ein.
Ergänzung zum Infoblatt 3/2005
Während der Erarbeitung des Infoblattes 3/2005 wurde vergessen den Autor des Artikels Der Leuchtturm auf der Greifswalder Oie zu nennen. Der Artikel wurde von unserem Vereinsmitglied Dieter Frenzel geschrieben. Die Fotos vom Leuchtturm auf der Greifswalder Oie stellte er uns ebenfalls freundlicherweise zur Verfügung. Wir bitten vielmals um Endschuldigung.
Vereinsinformation
Als neues Mitglied
in unserem Verein begrüßen wir recht herzlich
Herrn Ferdinand Erbe, Dresden
Herrn Werner Seipenbusch, Velbert Langenberg.
Wir wünschen ihnen viel Spaß und Freude
bei einer erfolgreichen Vereinsarbeit
Wir
danken für die Spenden
Herr Günther Wiechmann 50 Euro
Herr Gerhard Winkelmann 50 Euro
Peenemünde im Spiegel der Presse
Ostseezeitung 20. 05 2005
Wachsmantel
für alte Kessel
Im Museum Peenemünde wird die Konservierung des Kesselhauses jetzt
fortgesetzt. Viele ABM- Kräfte helfen dabei.
|
|
|
Zunächst
begannen 18 ABM-Mitarbeiter, von denen hier ein Großteil zu sehen ist, mit
der Arbeit. Die Gruppe soll demnächst um weitere zehn Mitstreiter aufgestockt
werden. OZ-Foto: T. S. |
Peenemünde Im Peenemünder Museum läuft
jetzt ein neues großes Vorhaben an. Direktor Dirk Zache stellte gestern eine
18-köpfige ABM-Gruppe der Öffentlichkeit vor. Das stillgelegte Kesselhaus des
einstigen Kohlenmeilers ist bis Mitte Februar nächsten Jahres die
Wirkungsstätte der gelernten Maurer, Maler, Elektriker und Metallbearbeiter.
In der Hauptsache geht es darum, die vorhandenen Kessel und die dazugehörigen Anlagen unter Anleitung eines Restaurators zu konservieren, erklärte der Museumschef das Ziel. Die Kesselwände werden behutsam gereinigt, zum einen mit Industriestaubsaugern und zum anderen mit Pinselchen. Anschließend erhalten die Wände einen zweischichtigen Wachsanstrich. Mindestens zwei Generationen lang soll der Wachsmantel das darunter befindliche Metall erhalten und dessen Korrosion stoppen.
Die Anlage selbst ein noch ursprünglich erhaltener Kessel der Firma Babcock und zwei um 1950 nachgerüstete Kessel des DDR-Betriebes SKET sei für viele Museumsbesucher ein spannendes interessantes Anschauungsobjekt. Das Interesse an unseren täglichen Kesselhaus-Führungen um 11 und um 15 Uhr ist schon jetzt groß, sagte Zache.
Neben der Konservierung der Dampferzeuger, Entaschungsaggregate, Bunker, elektrostatischen Filter und Wanderroste soll der informative Wandelgang auf der Zehn-Meter-Ebene noch attraktiver werden. Kleine Stationen sollen entstehen, an denen Wissenswertes über den Alltag der Kesselwärter vermittelt wird. Themen, wie Schutzanzug, Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen im Kesselinneren und Feuerung sollen den Gästen die einstige Kraftwerksatmosphäre erlebbarer machen.
In etwa einem Jahr soll das Projekt umgesetzt sein. Die Akteure können auf Erfahrungen aus den Jahren 1996/97 zurückgreifen. Damals waren bereits große Teile des ältesten der drei Kessel in der erwähnten Art und Weise eingemottet worden.
Die
zweite größere aktuelle Baustelle des Museums befindet sich vor dem
Verwaltungstrakt. Hier steht auf einem Gleis eine vor einiger Zeit aus Bayern
heran bugsierte Wageneinheit der früheren Peenemünder Werkbahn. Drei
ABM-Mitarbeiter kümmern sich mühevoll um die Restaurierung der 1941 auf Usedom
in Dienst gestellten Trieb-/Steuerwagen-Einheit. Hier ist laut Zache
vorgesehen, den Triebwagen zu zwei Drittel in den Ursprungszustand zurück zu
versetzen. Der übrige Teil der Vehikel soll die spätere Nutzung der Wagen,
unter anderem bei der Isartalbahn, dokumentieren und eine Ausstellung zur Peenemünder
Werkbahn beherbergen. Voraussichtlicher Fertigstellungstermin ist hier 2007.
TOM SCHRÖTER
Ostseezeitung 20.09.2005
Frische Farbe
für alte Werkbahn
Im Museum wird auf zwei größeren Baustellen gearbeitet. Zum einen werden die Kessel im Kraftwerk konserviert, zum anderen wird eine Werkbahneinheit restauriert.


Ostseezeitung 28. 09. 2005
Wir halten am
HTI -Charakter fest
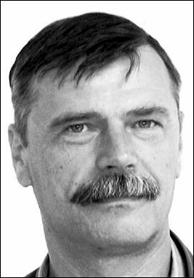
Zwischen Gemeinde und HTI -Beirat
fordert Peenemündes Bürgermeister eine bessere Kommunikation. Im Dezember soll
der Beirat tagen.
|
|
Mit dem neuen Mann an der Spitze des kommunalen Eigenbetriebes Historisch-Technisches Informationszentrum (HTI) erhofft sich Barthelmes einen Neuanfang. Ich hoffe nicht, dass er zu einem Einzelkämpfer wird, wie sich Herr Zache kürzlich sah, so Barthelmes, der in jüngster Zeit im Zusammenhang mit Zaches Weggang viele besorgte Anrufe bekommen hat. Von Disneyland oder Technikpark war da die Rede. Alles Quatsch. Am Konzept des Museums werden wir nichts ändern, betont Barthelmes.
Viele der Anrufer scheinen ein großes Defizit zu haben. Die Gemeinde verfügt über eine Eigenbetriebssatzung. Nur das ist für uns die Arbeitsrichtlinie, so der Bürgermeister. Über den Charakter des Museums entscheiden die Gemeinde und der wissenschaftliche Beirat des HTI (Gemeinde, Kreis, Land, Bund, Wissenschaftler und die Bundestagsabgeordneten Adam und Braune) in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetriebsleiter, stellt Barthelmes klar.
Dies habe der Bürgermeister in einem Brief an alle Beiratsmitglieder deutlich gemacht. Für Anfang Dezember soll der Beirat einberufen werden. Wir werden uns dann mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen und Schlussfolgerungen ziehen. Dann kommen auch Zahlen auf den Tisch. Die Runde wird hoffentlich eine Art Wegweiser, kündigt Barthelmes an. In der Zusammenarbeit mit dem Beirat sieht er aber noch erhebliche Reserven.
Von einem vernünftigen Umgang mit der Gemeinde spricht dagegen der Vorsitzende des Beirates, Dr. Christoph Ehmann. Mit dem Neuen an der Spitze des HTI hofft Ehmann auf eine Weiterentwicklung des Museums. Die Ausstellung muss moderner werden. Barthelmes geht noch ein Stück weiter: Wir brauchen zur Dauerausstellung auch wechselnde, attraktive Ausstellungen, die über einen längeren Zeitraum im HTI sind. Dem schon lange diskutierten Wechsel vom Eigenbetrieb in eine Stiftung steht der Bürgermeister auch weiterhin positiv gegenüber. Wir brauchen aber als Gemeinde mehr Informationen zur Stiftung. Man soll nicht nur über Verantwortung reden, sondern auch Verantwortung übernehmen, so Barthelmes in Richtung Land und Bund.
Bereits im Oktober werden in der Gemeinde die Wirtschaftsprüfer erwartet. Dann geht es um das Wirtschaftsjahr 2004. Im vergangenen Jahr blieb das HTI mit gut 260 000 Gästen weit
unter den Erwartungen, die bei 300 000 lagen. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde mit einer Besucherzahl von rund 275 000.
HENRIK NITZSCHE
Ostseezeitung, 29.09.2005
Förderverein sucht weiter engen Kontakt zum HTI
Peenemünde Im Zinnowitzer
Hotel Baltic trafen sich jetzt die Mitglieder des Fördervereins Peenemünde
zur Jahreshauptversammlung. Wie Klaus Felgentreu informierte, standen im
Mittelpunkt der Gespräche die weitere Darstellung der Peenemünder Geschichte.
In der Diskussion wurde zum Ausdruck gebracht, dass besonders eine enge
Zusammenarbeit mit dem HTI allen Vereinsmitgliedern am Herzen liegt. Dafür ist
ein zukunftsweisendes Konzept notwendig, das weitere Kontinuität in die
Museumsarbeit bringt, so Felgentreu. Der Verein möchte mit der Gemeinde und
dem neuen Leiter des HTI sachlich, fachgerecht und zukunftsorientiert
zusammenarbeiten.
Ostseezeitung, 01.10.2005
Historiker
übernimmt Zentrum Peenemünde
Peenemünde (OZ) Ein Historiker übernimmt die Leitung des
Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde (HTI). Einstimmig
votierten die Peenemünder Abgeordneten am Donnerstagabend in einer nicht
öffentlichen Sitzung für Christian Mühldorfer-Vogt, der seit sechs Jahren die
Städtischen Museen Quedlinburg leitet. Damit setzte sich der 44-jährige
Historiker und Kulturmanager unter 67 Bewerbern durch.
Der
dreifache Familienvater tritt am 1. Januar 2006 seine Stelle in Peenemünde an.
Das HTI kennt Mühldorfer-Vogt von einem Besuch vor fünf Jahren. Das Museum
genießt einen sehr guten Ruf. Ich war von der Ausstellung beeindruckt, meint
der Noch-Quedlinburger.
Dass
das Museum als Eigenbetrieb der Gemeinde geführt wird, sieht Mühldorfer-Vogt
nicht als Nachteil. Der knappe Handlungsspielraum eröffnet auch
Möglichkeiten. Der Neue sieht die Ambivalenz der Rakete A 4 als Kriegswaffe
und Entwicklungsschritt für die Raumfahrt im Peenemünder Museum sehr gut
dargestellt.
Ostseezeitung 01.10.2005
Historiker
freut sich auf reizvolle Aufgabe im HTI
Quedlinburg/Peenemünde Ein Historiker wird die Nachfolge von Dirk Zache als
Leiter des Historisch-Technischen Informationszentrums in Peenemünde antreten.
Christian
Mühldorfer-Vogt
(44), Leiter der städtischen Museen Quedlinburg, hat am Donnerstag in nicht öffentlicher
Sitzung von den Peenemünder Abgeordneten einstimmig (OZ berichtete) den
Zuschlag erhalten. Der dreifache Familienvater (Kinder sind 20, 17 und 12
Jahre) wird am 1. Januar 2006 seinen Job als HTI-Leiter aufnehmen.
|
|
|
Christian Mühldorfer-Vogt aus
Quedlinburg wird ab Januar 2006 als Leiter die Fäden des HTI in Peenemünde in
der Hand halten. |
Seit sechs Jahren leitete Mühldorfer-Vogt in Quedlinburg die drei städtischen Museen. Dazu zählen das Schlossmuseum, das Klopstockhaus und das Fachwerkmuseum im Ständerbau. Ich habe viel im zeitgeschichtlichen Bereich gearbeitet, meinte Mühldorfer-Vogt gestern am Telefon. Nach sechsjähriger Arbeit in Quedlinburg suchte der studierte Kulturmanager eine neue Herausforderung. Ich wurde auf die Peenemünder Ausschreibung aufmerksam und dachte mir, dass ich es doch mal versuchen könnte. Unter 67 Bewerbern setzte sich der Historiker letztlich durch.
Das HTI in Peenemünde kennt Mühldorfer-Vogt von einem Besuch vor fünf Jahren. Das Museum genießt einen sehr guten Ruf. Damals war ich von der Ausstellung beeindruckt. Eine interessante Aufgabe wartet auf mich, meint der Noch-Quedlinburger, der zunächst für ein halbes Jahr eine kleine Wohnung im Inselnorden beziehen wird. Im Sommer hole ich meine Familie nach.
Dass das Museum als
Eigenbetrieb der Gemeinde geführt wird, sieht Mühldorfer-Vogt nicht als Nachteil.
Der knappe Handlungsspielraum eröffnet auch Möglichkeiten. Der Neue sieht die
Ambivalenz zwischen der V 2 als Kriegswaffe und der Entwicklung für die
Raumfahrt im Peenemünder Museum sehr gut dargestellt. Die ersten Gespräche
drehten sich aber noch nicht um Konzepte, stellt Mühldorfer-Vogt klar. Noch in
diesem Jahr plant er mehrere Besuche in Peenemünde. Ich kann ja nicht am 1.
Januar mit einem Koffer dastehen und anfangen. Er freut sich auf Peenemünde.
Ein spannendes Thema. Das reizt mich.
H. N.
Ostseezeitung 04.10.2005
Projektgruppe
untersucht Vermarktungschancen
Peenemünde Wie kann Peenemünde noch besser vermarktet werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich im nächsten halben Jahr zehn Männer und Frauen, die im Rahmen einer Fördermaßnahme von der BQG Usedom-West in Peenemünde beschäftigt werden. Wie der Abgeordnete Frank Adam informierte, sollen die Mitarbeiter der Projektgruppe Flyer und Leitfäden erstellen, Schwachstellen in der Vermarktung Peenemündes aufdecken und den Ort historisch beleuchten. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, eine Konzeption über Peenemünde zu erstellen. Darüberhinaus sind derzeit 20 Beschäftigte über eine Fördermaßnahme damit beschäftigt, Anlagen im Kesselhaus des Kraftwerkes zu konservieren.
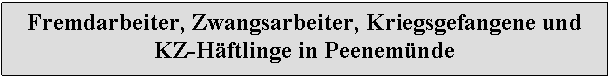
1. Teil
1.
Fremdarbeiter und
Zwangsarbeiter in Peenemünde
Zur Errichtung und zum
Betrieb der gewaltigen Peenemünder Anlagen wurde zu jeder Zeit eine Vielzahl
von Arbeitskräften benötigt. Für die Peenemünder Bauleitung ergab sich aus dem
ständigen Arbeitskräftemangel ein großes Problem, das sich nach Kriegsbeginn
noch weiter verschärfte. Zur Lösung dieses Problems versuchte man, trotz der
hohen Geheimhaltung, verstärkt auch ausländische Arbeitskräfte einzusetzen. Im
Mai 1940 gab es in einer Aktennotiz dazu folgende Richtlinien:
Der Einsatz der Arbeiter kann ohne weiteres im Hafen
Karlshagen, Barackenlager Karlshagen, in der Kläranlage und in der Siedlung
erfolgen, nachdem der Absperrzaun errichtet ist.... Die deutschen Arbeiter auf
diesen Baustellen sind dann gegen die ausländischen Arbeiter auszutauschen.
Darüber hinaus wird die Verwendung ausländischer Arbeiter im Waldgelände, also
z.B. bei der F1, bei den Gleisen, Wegen usw. bei entsprechender Bewachung erlaubt.
Dagegen nicht im Hafen, am Deich und da, wo Einblick in die Versuchsplätze
möglich ist. [23]
In den ersten Jahren des
Krieges wurden im großen Umfange Fremdarbeiter
(ausländische Zivilarbeiter, Vertragsarbeiter) vor allem aus Westeuropa
(Holländer, Belgier, Franzosen, Italiener) aber auch Polen und Tschechen [7]
nach Peenemünde geholt und durch die Baufirmen eingesetzt. Diese Arbeitskräfte
besaßen Arbeitsverträge und hatten in diesem Rahmen auch gewisse Rechte.[24]
Im Schriftverkehr der
Dienststellen wurden diese Arbeitskräfte als urlaubsberechtigte Ausländer bezeichnet [5]. Sie durften im Urlaub
den Arbeitsort verlassen und in ihre Heimatorte fahren. Unter starken
Einschränkungen konnten sie sich auch in der näheren Umgebung bewegen. In ihrer
arbeitsfreien Zeit am Sonntag, war es ihnen erlaubt, z.B. nach Zinnowitz zu fahren.[8,S.33]
Diese Fremdarbeiter (Polen, Franzosen, Italiener) waren vor 1941 im Lager der
Deutschen Arbeitsfront (DAF) in Karlshagen (das spätere VKN-Lager)
untergebracht. Dieses Lager war als Unterkunft für 5000 Personen vorgesehen.
Als Verbündete Deutschlands hatten die Italiener einige Privilegien. So
erhielten sie z.B. am Wochenende zum Mittagessen jeweils für zwei Personen eine
Flasche Wein. [3]
|
|
|
|
|
Das Barackenlager Karlshagen (VKN-Lager )
1943 |
|
Der polnische Arbeiter Leon Dropek |
Der polnische Arbeiter Leon
Dropek schilderte in einem Brief seine Eindrücke, als er im Juni 1940 in dieses
Lager kam. ...... Ich war verblüfft. In dem großen Kiefernwald standen wunderschöne,
wie Schmuckstücke anmutende Baracken fast an die Bäume gelehnt. Dort wohnten
die Deutschen, die in Peenemünde beschäftigt waren. Das Lager befand sich noch
im Bau, aber das, was schon zu sehen war, weckte in mir totale Begeisterung.
Die Baracken waren mit weißer Lackfarbe gestrichen, die Fenster und Türrahmen
waren rot. Das dunkle Grün der Bäume, die dicken, braunen Stämme der Kiefern im
Hintergrund machten auf mich einen fesselnden Eindruck. Innen eine Pracht und
Komfort. Es waren Achtbettzimmer mit Dusche, Bad , Warmwasser, Zentralheizung,
die Bettwäsche weiß wie Schnee. Diese Idylle dauerte sechs Wochen [Monate?] an. Ich bin überzeugt, dass das als
Propaganda für ausländische Missionen in Deutschland gedacht war..... [3]
Die polnischen Arbeiter
versuchten durch kleine Störaktionen die Arbeit der Lagerleitung zu erschweren.
So berichtet Leon Dropek in seinen Erinnerungen, dass sie saubere
Bettwäsche tauschen konnten, nachdem die schmutzige abgegeben wurde. Es gab
keine organisierte Sabotage, aber die Betten haben wir, ob nötig oder nicht,
jeden Tag gewechselt. Wir legten uns mit Absicht mit den schmutzigen Sachen in
die Betten, nur damit sie gewaschen werden mussten. Den Rekord im
Bettwäschewechseln schlug Jozef Grajek, Schmid von Beruf. Da an seinen Sachen
buchstäblich das Öl herunterlief, sahen auch die Betten dementsprechend aus.
Auf diese Art konnten wir uns für das Unrecht und Leid, das unserem Vaterland,
den vertriebenen Menschen durch die Übermenschen des Dritten Reichs zugefügt
wurden, ein wenig rächen. [3]
Da die Lagerführung die Probleme nicht in den Griff
bekam, wurde der Lagerführer Claus im Januar 1941 abgelöst. Die Unterbringung
der polnischen Arbeiter erfolgte nun in einem separaten Polenlager. Hier
waren die Lebensbedingungen sehr viel schlechter als im Lager Karlshagen. Die
alten Baracken waren voller Flöhe und Wanzen. Hier sah es so aus:
14-Bettzimmer ohne Bettwäsche, nur zwei alte Decken, geheizt wurde mit
Kohleofen, ein Waschraum nur mit kaltem Wasser befand sich in der nächsten
Baracke. Der Beschluss der Lagerleitung war uns klar, wir hatten keine Sonderrechte
gegenüber den anderen. Wir waren auch nur Söhne Polens. [3]
Ab 1941 wurden die
ausländischen Arbeitskräfte in einem großen Barackenlager zwischen Karlshagen
und Trassenheide untergebracht, dem Gemeinschaftslager Trassenheide, da das
Lager Karlshagen durch das Versuchskommando Nord der Wehrmacht und dem Reichsarbeitsdienst
genutzt wurde. Das Lager Trassenheide war ursprünglich für die deutschen Facharbeiter
errichtet worden, die im Versuchsserienwerk die Serienproduktion der A4 ausführen
sollten. Es besaß eine Belegungsmöglichkeit von ca. 4000 Mann. Das Lager war
von einem Zaun umgeben, der beim Bombenangriff im August 1943 vielen Arbeitern
zum Verhängnis wurde.
Der Ingenieur Walter Reuß
erklärt in einem Erfahrungsbericht vom 30. August 1943 über den Bombenangriff,
zum Lager Trassenheide: Der Drahtzaun um das Lager behinderte die Lagerinsassen
beim Flüchten ins Freie. Viele Menschen hätten sich retten können, wenn genügende
Ausgänge vorhanden gewesen wären. ..... Außerdem waren nicht genügend Splitterschutzgräben
vorhanden und diese befanden sich außerhalb des Lagers und konnten von den
Lagerinsassen wegen der Umzäunung nicht erreicht werden. [25] Als gerade einige Arbeiter versuchten, dieses
Hindernis zu überwinden, fiel die unter Strom stehende Hochspannungsleitung der
S-Bahn auf den Drahtzaun und tötete diese Menschen.
Im Lager Trassenheide lebten neben den ausländischen Arbeitern auch dienstverpflichtete deutsche Bauarbeiter. In dem Lager gab es Verkaufsstellen, in denen sich die Arbeiter mit Lebensmittel und Tabakwaren versorgen konnten.
|
|
|
Das Gemeinschaftslager Trassenheide |
Es soll dort auch ein Bordell
vorhanden gewesen sein. Wollten die Arbeiter das Lager verlassen, war ein
Antrag zu stellen, der genehmigt werden mußte. Die ausländischen Arbeitskräfte
kamen in Peenemünde aus Sicherheitsgründen nicht in der Raketenentwicklung und
der Raketenfertigung zum Einsatz. Sie wurden durch verschiedene Baufirmen auf
dem Gelände der Peenemünder Versuchsanstalten oder der näheren Umgebung eingesetzt.
So waren z.B. vom Frühjahr 1941 bis Frühjahr 1942 110 italienische
Metallarbeiter an der Errichtung des Kraftwerkes beteiligt [26]. Ebenfalls
wurden die Italiener bei den Arbeiten am Deich eingesetzt.
Im Laufe des Krieges kamen in
Peenemünde außerdem Zwangsarbeiter
aus verschiedenen osteuropäischen Ländern (Polen, Sowjetunion [Ukraine]) zum
Einsatz. Diese Arbeitskräfte wurden zum Teil gegen ihren Willen zur Arbeit in
den Rüstungsbetrieben gezwungen. Sie wurden als nichturlaubsberechtigte Ausländer bezeichnet [5].
Das Polenlager befand sich
zuerst in der Peenestraße, gegenüber vom VKN-Lager. Lagerführer war ein Herr
Bauer, der als äußerst brutaler Mensch dargestellt wird.
Gleich neben dem Polenlager
standen zwei eingezäunte Baracken in denen Jugoslawen und Franzosen
untergebracht waren. Sie nutzten mit den Polen einen gemeinsamen Speiseraum
[3+8]. Auch die Zwangsarbeiter wurden durch verschiedene deutsche Firmen vor
allem zu Bau- und Reparaturarbeiten auf dem Versuchsgelände eingesetzt.
Gearbeitet wurde von Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Am
Sonnabend wurde bis Mittag gearbeitet und sonntags war arbeitsfrei.[10]
Polnische Arbeiter, die sehr gute Arbeitsleistungen vollbrachten, erhielten von
ihren Firmen ebenfalls Heimaturlaub. [3]
Die Verpflegung bestand für
einen Tag aus 250 Gramm Brot mit Marmelade und abends einer Suppe, die aus
Graupen, Kartoffeln oder Kohlrüben bestand. Fleischeinlagen gab es selten und
dann in geringen Mengen. An den Sonntagen gab es zusätzlich ein Stück Kuchen
von etwa 100 Gramm, damit man wußte, es
war Sonntag. Die Arbeiter erhielten eine geringe Entlohnung, von der sie
sich im Lager Lebensmittel kaufen konnten. Zigaretten wurden ohne Bezahlung an
alle Arbeitskräfte ausgegeben.[10]
Im Polenlager bestand eine
Musik- und Theatergruppe, die im Lager verschiedene Programme aufführte. [8]
2
Kriegsgefangene in
Peenemünde
Eine
weitere Personengruppe, die im Bereich der Peenemünder Anlagen arbeitete, waren
die Kriegsgefangenen. Neben
Franzosen waren es besonders sowjetische Kriegsgefangene die
hier
eingesetzt wurden. Die französischen Kriegsgefangenen wurden entsprechend der
Genfer
Konvention behandelt. Sie
wurden vom Internationalen Roten Kreuz betreut und durften Pakete aus der
Heimat empfangen.[4]
Für sowjetische Gefangene gab
es jeweils ein Gefangenenlager in der Nähe des Hafens von Karlshagen und im
Tannencamp Wolgast. Diese beiden Lager unterstanden dem Stalag II C in Greifswald.
[6]
 Das Lager im Tannencamp wurde im Sommer 1942
errichtet. In ihm befanden sich ungefähr 300 sowjetische Ingenieur-Offiziere,
die bis August 1943 als Konstrukteure für das Entwicklungswerk der
Heeresversuchsanstalt eingesetzt wurden.
Das Lager im Tannencamp wurde im Sommer 1942
errichtet. In ihm befanden sich ungefähr 300 sowjetische Ingenieur-Offiziere,
die bis August 1943 als Konstrukteure für das Entwicklungswerk der
Heeresversuchsanstalt eingesetzt wurden.
Dieses Lager bestand aus
sieben Baracken. Davon waren zwei Unterkunftsbaracken, ein Waschhaus, eine
Küche mit Lagerraum, eine Baracke mit Speisesaal und Aufenthaltsraum und eine
Baracke mit Konstruktionsräumen. In einer weiteren Baracke befanden sich eine
Krankenstube und das Arrestlokal. Ebenfalls gab es eine Latrine. Das Lager war
mit 2 Stacheldrahtzäunen gesichert und am Lagertor befanden sich ein
Wachgebäude und ein Wachturm. Die Bewachung erfolgte durch eine Gruppe
Landesschützen unter Führung eines Feldwebels. Diese Wache wurde durch das
Stammlager Greifswald gestellt. Auch im diesem Kriegsgefangenenlager gab es
einen Lagerchor und eine Theatergruppe. [13]
Das Lager in Karlshagen
bestand aus fünf Baracken. In zwei Baracken waren sowjetische Gefangene
untergebracht und in den anderen beiden Franzosen. Das fünfte Gebäude war eine
Sanitärbaracke, die geteilt war, die eine Seite für die Franzosen und die
andere für die sowjetischen Soldaten. Ungefähr 180 (400 [13]) sowjetische
Gefangene befanden sich in diesen Unterkünften. Die sowjetischen
Kriegsgefangenen kamen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. So in der Wagenhalle
für die S-Bahn und in einigen Handwerkerstuben, wo für den Bedarf der
Werksangehörigen von Peenemünde gearbeitet wurde.[4] Für die beiden
sowjetischen Kriegsgefangenenlager war der Adjutant des Kommandeurs des EW, Oberleutnant
Bornträger verantwortlich. Nach seinen Aussagen wurden beide Lager für
sowjetische Kriegsgefangene nach dem Bombenangriff im August 1943 aufgelöst.
Dieser Aussage widerspricht ein Dokument aus dem Jahre 1944. Laut diesem
Schreiben waren im August 1944 bei der Elektromechanischen Werke GmbH
Karlshagen insgesamt 253 sowjetische Kriegsgefangene in der Fertigung
beschäftigt. Von weiteren 126 Ostarbeitern arbeiteten 18 Männer in der
Konstruktionsabteilung, 52 in der Fertigung, 53 in der Verwaltung und 3
weibliche Arbeitskräfte in der Elektrotechnischen Abteilung. Sie alle wurden in
den Unterlagen als Lohnempfänger geführt. [19].
Im März 1943 kamen die
Franzosen in ein anderes Gefangenenlager. In den Baracken wurden nun
Arbeitskräfte aus der Ukraine, sogenannte Ostarbeiter,
untergebracht. Diese Leute kamen überwiegend aus der ehemaligen polnischen
Ukraine und trugen auf ihrer Kleidung einen Aufnäher mit dem Wort Ost. Ihnen
war jeder Kontakt mit den Kriegsgefangenen untersagt. [4]
Fortsetzung folgt
Manfred Kanetzki
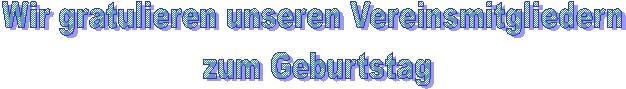
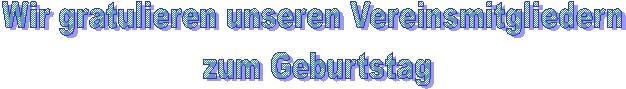
Im Oktober hatten
Geburtstag
|
|
|
Herr Jörg Felgentreu |
|
|
Herr Thomas Lange |
|
|
Herr Wolf-Eckhard Fiedler |
|
|
Herr Günter Wiechmann |
|
|
Herr Dipl.Ing. Ottmar Wegner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Im November haben
Geburtstag
|
Im Dezember haben Geburtstag |
|
Herr Uwe Scherf |
Frau Anne-Marie Pape |
|
|
Herr Heinz-Jürgen Rieck |
|
|
Herr Volkmar Schmidt |
|
|
Herr Botho Stüwe |
|
|
Herr Dr. Joachim Wernicke |
|
|
Herr Klaus Getzin |
|
|
Herr Konsul Helmut E.W. Niethammer |
|
|
|
In eigener Sache
Die Bankverbindungen unseres Vereins
Beitragskonto: 384 000 487
Spendenkonto: 384 001 432
Für beide Konten:
Die Bankleitzahl: 150 505 00 Bank: Sparkasse Vorpommern
![]()
Impressum
Herausgeber:
Verein zur ,,Förderung und Aufbau eines Historisch-Technischen Museums
Peenemünde -Geburtsort der
Raumfahrt"
e.V., Peenemünde
Anschrift:
Förderverein Peenemünde e. V. Am
Maiglöckchenberg 21 17449 Karlshagen
Tel./Fax:
038371/25479 (mit Anrufbeantworter)
e-mail: fvpeenemuende@aol.com
Homepage: www.foerderverein-peenemuende.de
Gestaltung:
Lutz Hübner und Klaus Felgentreu, Karlshagen
Layout und
Druck: G. Helm, Norderstedt
Alte
Rechte, einschließlich Fotokopie, Mikrokopie, Verfilmung, Wiedergabe durch
Bild-, Ton- oder Datenträger jeder Art und des auszugsweisen Nachdrucks,
vorbehalten. Die Vervielfältigung des Ganzen und von Teilen hieraus ist nicht
gestattet, außer nach Einwilligung. Strafbar macht sich, wer in anderen als den
gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung der/des Berechtigten ein Werk
vervielfältigt.